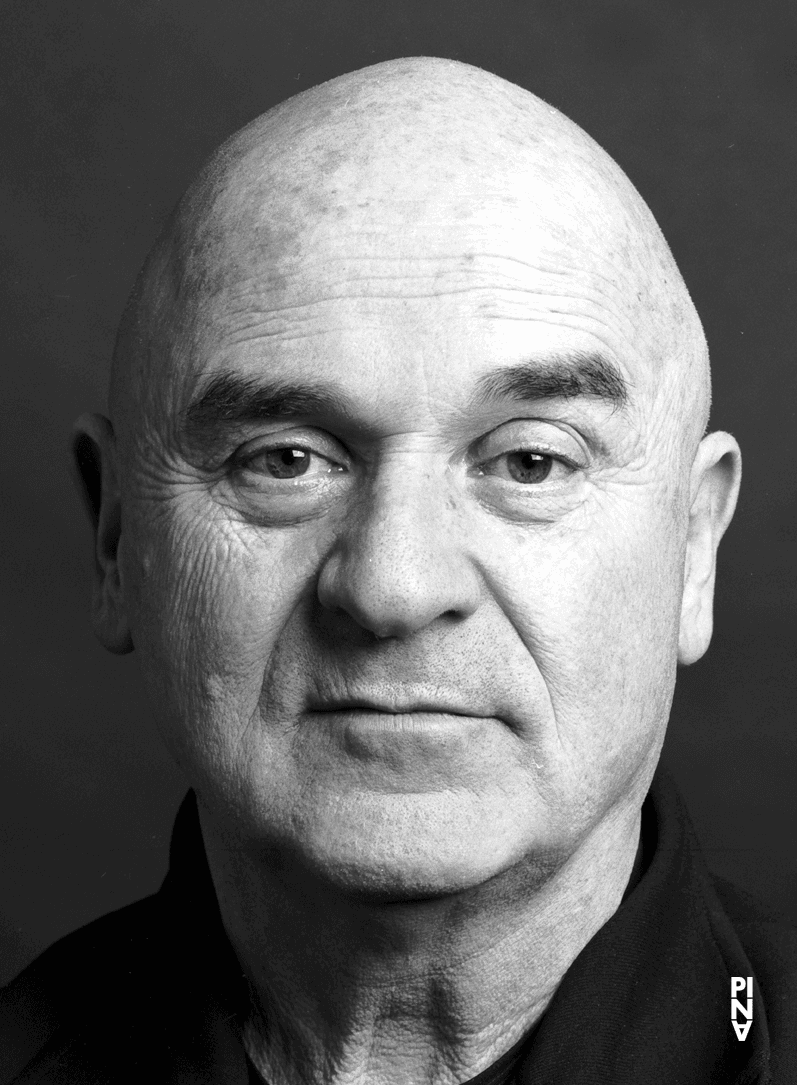Nelken muss man trösten – Peter Pabst im Gespräch mit Wim Wenders
Peter Pabst hat 2010 das Buch Peter für Pina veröffentlicht. Neben vielen Fotos seiner Bühnenbilder ist ein Interview mit Regisseur und Fotograf Wim Wenders abgedruckt.
Wim Wenders und Peter Pabst im Gespräch
Wim Wenders: Also Schwebebahn vor dem Fenster! Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen.
Peter Pabst: Deswegen bin ich hierher. Der hat so eine Geschichte, der Raum hier. Ich bin doch beim Tanztheater immer als Freelancer gewesen und hatte im Theater nie einen Platz zum Arbeiten. Und irgendwann habe ich in dieser Büroetage Asyl bekommen und habe mir zwei Räume genommen. Das ist direkt um die Ecke von der Lichtburg, wo Pina geprobt hat. Mir ist dann aufgefallen, dass sie gerne herkam. Sonst kam Pina nie, sich ein Modell anzugucken, das war immer schwierig. Ich hatte schon angefangen, die Modelle mit Video aufzuzeichnen, und hab die Kassetten auf die Probe gebracht, damit Pina sie überhaupt ansah. Aber hierher kam sie! Das fand ich gut. Und als später klar wurde, dass wir uns mit der Compagnie woanders ansiedeln mussten, habe ich gesagt: „Sollen wir nicht dahin gehen, wo ich schon bin?“ Und dann sind wir hierhergezogen und dann ...
Wim Wenders: ... dann habt ihr euch sofort die besten ...
Peter Pabst: ... wir haben sofort die Schwebebahnseite besetzt, auf der Stelle, und darüber bin ich auch heute noch froh. Hier fuhr die Schwebebahn vorbei und da unten in der Wupper stand auf einem Stein immer ein Reiher. Das war unser Reiher, den liebten wir.
Wim Wenders: Das ist auch wichtig, einen guten Platz zu finden. Das bringt mich aufs Thema:
Tänzer brauchen Platz zum Tanzen, die brauchen im wahrsten Sinne des Wortes „Spielraum“, manchmal auch „Spielwiesen“. Was kann der Bühnenbildner da noch dazutun? Bist du nicht in gewissem Sinne ein Landschaftsarchitekt?
Peter Pabst: (Lacht.)
Wim Wenders: (Lacht.) Du siehst, ich habe mich vorbereitet.
Peter Pabst: (Lacht.) Ich war so neugierig, womit du kommen würdest.
Wim Wenders: Mit irgendwas muss man ja anfangen. Also erst mal nur so als Provokation: „Landschaftsarchitekt“?
Peter Pabst: Nicht wollend, aber auf eine bestimmte Art und Weise schon, das ist klar. Das Denken fängt beim Boden an, glaube ich, wenn ich versuche mich an die Prozesse zu erinnern.
Wim Wenders: Du musst viel über Böden wissen, oder? Wie viele Tanzböden kennst du? Was weißt du alles darüber?
Peter Pabst: Inzwischen weiß ich schon einiges über Tanzböden. Über das Aussehen, über die Flexibilität, über ihre Sanftheit oder ihren Widerstand, über den Klang der Böden oder ihre Stummheit. Ich erfinde ja ständig neue Böden als Tanzböden. Aber erst mal weiß ich – und das war ein ganz wichtiges Wissen für das Stück, das du gerade gefilmt hast, nämlich Vollmond – dass ein Tanzteppich, wenn da Wasser draufkommt, für die Tänzer die Hölle ist. Die fallen nämlich sofort auf den Hintern.
Wim Wenders: Das ist doch nicht das erste Mal, dass bei Pina was nass wird?
Peter Pabst: ... aber nie auf Tanzteppich! Das waren vorher nie Tanzböden. Wenn da Wasser war, war immer was anderes drunter. Bei Arien zum Beispiel, als sie das erste Mal wirklich die Bühne voller Wasser hatten – wo ich immer eifersüchtig war und eigentlich gerne gehabt hätte, dass das mein Bühnenbild gewesen wäre –, da war ein alter Sisalteppich drunter. Das war auch eine Phase, in der sie nicht so viel getanzt haben.
Ich habe ihnen dann mal eine Insel gebaut, die sich bewegt hat, weil ich dachte, ein beweglicher Boden kann doch ganz schön sein für Tänzer. Da habe ich also eine große Insel gemacht, so gut hundert Quadratmeter etwa, die schwamm im Wasser und bewegte sich, genauer gesagt, die wurde bewegt durch die Bewegungen der Tänzer.
Wim Wenders: Welches Stück war das?
Peter Pabst: Das hieß Trauerspiel.
Wim Wenders: Ach ja, ganz genau.
Peter Pabst: Da haben sie halt auf der Insel getanzt, die im Wasser schwamm, und die Insel war bedeckt mit Hochofenschlacke – gemahlene Hochofenschlacke war das –, eine Gemeinheit für die Tänzer, so ein Material.
Wim Wenders: Das ist eine meiner ersten Fragen, was da alles herumlag auf dem Boden.
Peter Pabst: Ja, furchtbar ...
Wim Wenders: ... Hochofenschlacke war das also in dem Fall ...
Peter Pabst: ... die war so schön, weil sie gefunkelt hat und weil sie schwarz war. Aber sie war wie gemahlenes Glas. Ich wollte einen schwarzen Boden haben, das sollte alles schwarz sein: schwarzes Wasser und schwarzer Boden, und hab gesucht und natürlich fällt einem dann ein ... wie heißt denn diese kleine Insel in der in der Nähe von Teneriffa?
Wim Wenders: Lanzarote.
Peter Pabst: ... Lanzarote fällt einem dann ein mit seinem schwarzen Lavasand, aber irgendwie war das Zeug nicht zu kriegen. Und dann bin ich draufgekommen, dass die hier die Hochofenschlacke – also ein Nebenprodukt aus der Stahlherstellung – mahlen. Und dieses Granulat wird benutzt, um große Stahlkonstruktionen, wie Brücken zum Beispiel, zu sandstrahlen.
Wim Wenders: Für die Gegend hier – also zumindest für das Ruhrgebiet – ein lokaler Werkstoff.
Peter Pabst: Genau, das hab ich auch gerne. Ich guck ja nicht so gerne in Kataloge für Theatermaterialien, ich suche immer gerne nach den lokalen Dingen, die ich irgendwie hier finden kann.
Wim Wenders: Womit hast du den Boden für Vollmond rutschfest gemacht?
Peter Pabst: Das, na ja, das war die schwierigste Aufgabe, weil Pina hatte mir gesagt: „Wir machen viel mit Wasser.“ Das sind oft die ersten Andeutungen – wenn ich nicht dabei gewesen bin auf den Proben –, dann sagt sie mir so was und dann weiß ich also schon mal, na, das wäre jetzt gut, wenn das Bühnenbild den Gebrauch von Wasser zulassen würde (lacht).
Ich wollte gerne einen Fluss machen. So einen dunklen, stillen, ruhigen Strom. Ich wusste aber auch, dass die Tänzer viel tanzen würden. Und zwar auf der ganzen Bühne. Pina hatte mir auch gesagt, dass das am Ende sehr wild und ungebremst werden würde. Wenn da viel Wasser auf der Bühne sein würde, dann würde das sehr nass werden. Mir war also klar, dass ich einen Tanzteppich finden musste, der es den Tänzern ohne Angst und ohne Einschränkung erlauben würde, ihre Tänze zu tanzen. Egal, ob der Boden trocken oder nass ist. Eine Bremse wollte ich eigentlich nie sein als Bühnenbildner. Und das war dann auch mit das Komplizierteste ...
Wim Wenders: Das Material gab es?
Peter Pabst: Nein, das Material gab es erst mal nicht, und ich habe dann überlegt, wo es denn öffentliche Orte mit dem gleichen Problem gibt. Da gibt es ja ebenfalls strenge Vorschriften für die Sicherheit. Die müssten ja das Problem eigentlich gelöst haben. Öffentliche Schwimmbäder zum Beispiel, dachte ich, sind solche Orte.
Zu dieser Zeit waren die Olympischen Winterspiele in Turin. Ein italienischer Freund von mir hatte den Platz entworfen, auf dem die abends immer die Siegerehrung veranstaltet haben. Wir hatten früher schon über die Gestaltung dieses Platzes diskutiert. Diesen Freund hab ich dann auch angerufen und ihn gefragt: „Was hast du denn da für einen Boden benutzt?“ Weil da ja auch viel Publikum war und es nass war und geschneit hat. Also, ich habe immer in diesen praktischen Ecken rumgesucht.
Und auf diese Weise habe ich in Hamburg einen Mann gefunden, der sich damit beschäftigte, Flächen, die von Wasser bedeckt sind, begehbar zu machen – gut für meinen Fluss.
Und ich fand eine Firma, die machte rutschfeste Kunststoffböden. Die waren zwar nicht so gut für das Theater, sehr teuer, sehr schwer und sehr spröde – aber es war immerhin etwas. Nur stellte sich dann leider heraus, dass dieser Tanzboden in trockenem Zustand nun wieder zu rutschfest war. Der machte den Tänzern die Füße kaputt.
Ich habe dann endlos herumexperimentiert, mit den Tänzern auf kleinen Stücken immer wieder ausprobiert, aber es war nie wirklich gut und es sollte doch eigentlich ganz toll sein.
Das Ende hört sich dann an, wie eine ausgemachte Narrengeschichte: Ich hab den Boden, der zu stumpf war, mit einer ebenfalls rutschfesten Farbe bespritzt, die aber geschmeidiger war.
Wim Wenders: Ansonsten hast du dich auf schwarze und weiße Böden beschränkt? Was hast du sonst noch für Tanzböden erfunden?
Peter Pabst: Tanzböden hab ich hier nie in Farben gemacht. Woanders im Theater hab ich Tanzteppich auch in anderen Farben benutzt, aber eben nicht zum Tanzen.
Wim Wenders: Also mit Pina immer nur schwarz und weiß?
Peter Pabst: Hier ist es schwarz und weiß, nichts anderes.
Wim Wenders: Ist ja auch irgendwie am schönsten, um die Tänzer hervorzuheben.
Peter Pabst: Ja, hier haben mich die Farben nicht interessiert. Inzwischen gibt es ja ganz viel Material, ich habe mal rumprobiert mit einem transparenten Tanzboden. Den habe ich irgendwann in Frankreich aufgetrieben.
Wim Wenders: Was ist denn dann drunter?
Peter Pabst: Im Modell hab ich da endlos mit rumgespielt, mit Farben und mit Licht, und dann habe ich Fotos druntergelegt, das war ganz verrückt.
Wim Wenders: Ich hab das auch mal gemacht in meinem Büro.
Peter Pabst: Aha.
Wim Wenders: Ich hatte einen großen Büroraum, etwa achtzig Quadratmeter, und da hatte ich ein Luftbild der Stadt Venedig ausgelegt. Das war eine wunderschöne Aufnahme von Venedig, jeder Kanal und jedes Haus waren da zu sehen. Das haben wir mit Plexi verschweißt, verlegt und so konnte man über Venedig gehen. Das war schön.
Peter Pabst: Das ist was Schönes, weil es verrückt ist. Also, da habe ich mich auch ziemlich amüsiert, das war eine sehr freudvolle Phase, kann ich mich erinnern. Der Tanzteppich, den ich da gefunden hatte, war eigentlich wie Milchglas, da konntest du gar nichts durch sehen eigentlich – etwas, was wir bei den Probearbeiten für die Tür in Café Müller hätten brauchen können, fällt mir jetzt ein –, aber wenn du es hingelegt hast und hast was darunter gehabt, hast du das wie durch ein klares Glas gesehen, außer dass das klare Glas ein Tanzboden war.
Wim Wenders: Habt ihr nie getanzt auf dem Boden?
Peter Pabst: Nein, wir haben den dann doch nicht benutzt, weil ich ein anderes Bühnenbild gemacht habe. Das war Nefés, wir haben ihn dann später benutzt in Água, da gibt es so eine komische kleine Szene, wo zwei Tänzer da drunterkriechen. Das sah dann aus, als wenn sie in trübem Wasser tauchen.
Wim Wenders: Wie fing deine Arbeit mit der Pina an? Du hast 1980 das erste Stück mit ihr gemacht, das hieß auch gleich so.
Peter Pabst: Nicht gleich, aber ziemlich schnell, ja.
Wim Wenders: War ja eine schwere Arbeit nach dem Rolf, also dann in Wuppertal Bühnenbild zu machen.
Peter Pabst: Ja, war schwer, aus vielen Gründen.
Wim Wenders: Erzähl mir mal von dem Stück 1980. Da steht ein Reh auf der Wiese.
Peter Pabst: Na ja, bevor das Reh dahin kam, musste da erst mal die Wiese sein.
Wim Wenders: Das war wirklich eine „Spielwiese“.
Peter Pabst: Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind schon wieder beim Boden.
Das Erste, was ich von der Arbeit an 1980 erinnere, ist eine ganz tastende Situation, die nur von Scheu und Vorsicht geprägt war. Das war ja wirklich schwierig. Also ich wusste um die Trauer, ich wusste um den Verlust, ich wusste um die enge Beziehung zwischen den beiden und die Bedeutung von Rolf Borzik für Pina. Da war es schon erst mal kompliziert, überhaupt den Entschluss zu fassen und zu sagen: „Gut ich mache das.“ „Ich versuche das mal.“ „Ich mache das“ kann man ja eh nicht sagen, bloß „Ich versuche das mal“.
Wim Wenders: Das Scheue war dann in dem Reh auch drin?
Peter Pabst: Vielleicht (lacht), dafür ist das scheue Reh dann in den vielen Jahren danach ziemlich gerupft worden (lacht). Aber es hat durchgehalten und gehört inzwischen zu den ältesten Mitgliedern des Tanztheaters.
Ja, das war so: Du bist natürlich auch unter einem enormen Druck und denkst, du musst irgendwas Tolles machen oder so. Und ich hab probiert und probiert, alle möglichen Bühnenbilder und Modelle gebaut und wir haben immer wieder versucht – ich glaube, man kann das so sagen, versucht –, uns zu unterhalten, miteinander zu sprechen, was man ja erstaunlicherweise auch immer erst lernen muss – dass man miteinander reden kann. Oder eines Tages so weit kommt, dass man nicht mehr reden muss. Und ...
Wim Wenders: Pina ist ja nicht besonders gesprächig gewesen.
Peter Pabst: Nein, wahrhaftig nicht, aber eigentlich war das kein Problem zwischen uns.
Vor nicht so langer Zeit hatten wir unser erstes Gastspiel in China, in Peking, und die Direktorin des Chinesischen Nationalballetts, Zhao Ruheng, hatte gebeten, dass Pina und ich vorher mal für zwei oder drei Tage dorthin kommen, für eine Pressekonferenz und um dort Leute kennenzulernen. Sie wollte auch gerne ein Gespräch mit chinesischen Künstlern organisieren und in diesem Gespräch fragte jemand: „Wie gestaltet sich Ihre Zusammenarbeit? Wie diskutieren Sie, wie sprechen Sie miteinander?“ Und ich habe gesagt: „Na ja, also, das ist natürlich jetzt nach so einer langen Zeit“ – da hatten wir schon fünfundzwanzig Jahren zusammen gearbeitet –, „nach fünfundzwanzig Jahren, da müssen wir dann doch nicht mehr zu viel reden.“ Da hat man schon so viele gemeinsame Bilder im Kopf, also es sind ja unendlich viel mehr als die, die ich wirklich gemacht habe, da haben wir ja tausend Gedanken gedacht, tausend Bilder gesehen, die nicht gemacht worden sind.
Jedenfalls hat Pina mich damals unterbrochen und gesagt: „Mein Lieber, wir haben nie viel miteinander reden müssen.“ Ich fand das sehr schön, weil das ist vielleicht eines der Geheimnisse, warum wir so lange, so fruchtbar und mit so viel Freude aneinander haben arbeiten können.
Wim Wenders: Und trotzdem habt ihr das ja zum ersten Mal damals gemacht: 1980, die Wiese, wie ist denn das alles entstanden, das Reh und die Scheinwerfer und das erste Bühnenbild, das du mit Pina gemacht hast?
Peter Pabst: Das ist eigentlich ganz blöd passiert, nach endlosen Umwegen. Wir hatten sogar überlegt, ob ich einfach ein Bild von davor nehme, weil uns die Zeit davonlief, ob wir den Raum von Kontakthof nehmen, und ich baue einen Gemüsegarten rein (lacht), also dass da lauter Kohl drin wächst. Wie gesagt, es war die Phase des nicht so sehr exzessiven Tanzens. Und dann erinnere ich mich, habe ich – in einem anderen Zusammenhang – in einem sehr schönen Buch über Fellini geblättert – der Peter Zadek hatte mir das gerade geschenkt – und da war ein Foto drin, von den Dreharbeiten zu „La dolce vita“ glaube ich, eine Aufnahme von einem Nachtdreh. Da war eine Wiese und da war die ganze Technik von dem Film drauf und so. Die Szene war in so ein unwirkliches Licht getaucht, wie oft, wenn man die Nacht zum Tag leuchtet. Ich hab gedacht: „Ach, das ist aber schön!“ Und hab mir vorgestellt: Wenn ich die ganze Bühne aber wirklich leer räume, bis an die Mauern, und einen echten Rasen darauflege, dann steht doch das Theater auf einer Wiese und dann wird es nach Gras riechen und da werden auch Insekten rumtollen im Licht der Scheinwerfer. Ich habe dann Pina das Foto gezeigt und sie hatte auch Lust darauf und dann habe ich angefangen. So ging das los.
Wim Wenders: Also so ein Rasen zum Ausrollen?
Peter Pabst: Den man so kauft.
Wim Wenders: Muss man den denn gießen?
Peter Pabst: Ja, den muss man gießen. Und man muss ihm Licht geben und ihn belüften und ihn manchmal auch mähen.
Und am Anfang musste man ihn auch säubern. Das ist eine meiner liebsten Erinnerungen. Damals, 1980, wurde dieser Rollrasen noch richtig in der Erde gezogen. Der wurde dann mit speziellen Schälmaschinen etwa fünf bis sechs Zentimeter unter der Oberfläche von der Wiese abgeschält. Das waren also drei Schichten: Grashalme, Wurzeln und Erde, und so wurde er in einzelnen Bahnen aufgerollt und ins Theater geliefert. Und als wir nun die erste Lieferung auf der Bühne ausgerollt hatten, war der natürlich ganz schmutzig, weil die Erde von der Unterseite auf den Halmen der Oberseite hängen geblieben war. Im Garten hätte die der erste Regen weggewaschen, aber bei uns auf der Bühne hat es ja nun nicht geregnet.
Also habe ich damals den Hausmeister gefragt, ob er mir nicht zwei Putzfrauen auf die Bühne schicken kann mit Staubsaugern, damit sie den frischen Rasen saugen. Er hat das auch gemacht und ich habe mich still in den Zuschauerraum gesetzt und den beiden Damen in ihren blauen Kitteln zugeschaut, die nun die allerersten „Besucher“ auf meiner Wiese waren, und ich habe mir angehört, was sie zu sagen hatten über diesen Narren, der sich so einen Unsinn ausgedacht hatte.
Inzwischen ist das alles Erinnerung, weil Rollrasen schon längst nicht mehr in Erde gezogen wird, sondern erd- und keimfrei mit Nylonnetzen verwachsen.
Wim Wenders: Konnten die Tänzer sich da gut drauf bewegen? War das für die das erste Mal auf so einem Boden oder ...
Peter Pabst: ... nein, diese Wiese war zwar neu, aber sie hatten schon ihre Erfahrungen gemacht. Ich habe da ja nicht eine neue Bewegung in Gang gesetzt. Sacre war schon da gewesen, mit dem Torf, es hatte Arien gegeben mit dem Wasser, das waren ja immerhin schon widerspenstige, schwierige Böden. Ich glaube, die Blätter, die es in Blaubart gegeben hat, die waren da nicht so prägend, also prägend meine ich jetzt im Hinblick auf die Verlängerung in den Körper, auf den Einfluss auf die Bewegungen. Also die Erfahrung war nicht völlig neu, nur das Gras war neu und die Technik, die wir sowieso brauchten.
Wim Wenders: Da habt ihr dann einfach nur sichtbar gemacht, was vorher unsichtbar blieb ...
Peter Pabst: ... wir haben das, was man sonst versteckt, die ganze Beleuchtungstechnik, Kameras, Monitore und so weiter, das haben wir einfach auf die Wiese gestellt. Das ist etwas, was ich eh ganz gerne habe. Ich bin ja eher so ein Schlamper, ich bin ja nicht so ein Ästhet, eher jemand, der das ein bisschen schluderig macht, jedenfalls wurde die Wiese immer verkramter. Und dann habe ich irgendwann ein Reh angeschleppt. Das war gar nicht so einfach.
Wim Wenders: Wo hast du das gefunden?
Peter Pabst: Da hab ich rumtelefoniert bei Naturkundemuseen und bei Tierpräparatoren, wer so was hat.
Wim Wenders: Sieht aus wie Bambi.
Peter Pabst: Ich weiß noch, dass Pina mit mir einen Moment lang überlegt hat, ob das Stück „Bambi“ heißen sollte (lacht). Also, da habe ich immer rumtelefoniert, wer so ein Reh hat, bis ich eins gekriegt habe. Ich habe erst später gelernt, dass es in manchen Ländern ganz schön schwierig sein kann, mit einem präparierten Reh einzureisen.
Und dann gibt es auch einen Rasensprenger auf der Wiese. Diese Sachen, diese Banalitäten, die haben dann plötzlich funktioniert, die man sonst gar nicht machen könnte – im Theater ging das.
Wim Wenders: Das interessiert dich, glaub ich, das reizt dich, wenn was nicht geht, wenn jemand sagt „unmöglich“, dann bist du sofort dabei, ne?
Peter Pabst: Ja.
Wim Wenders: Dann willst du es machen ...
Peter Pabst: ... sonst, denke ich oft, bin ich eher so ein bisschen lahm, aber wenn dann was nicht geht, das kann ich nicht haben ... Also, ich verliere auch nicht gerne, das muss ich zugeben (lacht). Das will ich nicht.
Wim Wenders: An welchem Zeitpunkt setzt denn was ein? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Auf der einen Seite die szenischen Ideen von Pina, die tänzerischen Ideen, und dann gibt es das große Puzzle, wenn man so sagen will, des vorgegebenen Themas, wenn man das überhaupt Thema nennen kann. Wo kommen da die visuellen Ideen rein? An welchem Zeitpunkt schleichst du dich rein oder gleitest du hinein? Oder wie befruchtet sich das gegenseitig? Das würde ich gerne mal wissen. Wann kommen aus der Probebühne Ideen zu dir, wo du dann sagen kannst: „Jetzt kann ich anfangen?“
Peter Pabst: Man denkt immer, es gäbe da so einen Ausgangspunkt, so einen konkreten Anfang. Wie du sagst: „Jetzt fangen wir an, jetzt lege ich los!“ Nach meiner Erfahrung stimmt das auch für den Film, für die Oper und meistens für das Theater, aber nicht für die Arbeit mit Pina. Es gab bei Pina ja nicht wirklich eine Voraussetzung für so einen „point of departure“: einen Text, tänzerische Ideen, Musik oder so. Eigentlich wurde mir immer erst nachträglich bewusst, dass ich schon angefangen hatte.
Klar, am Anfang hatte ich das Problem mit meinem Modellkasten, der mich schwarz angegähnt hat. Bei diesem Problem konnte mir Pina aber auch nicht helfen. Sie hatte ja auch noch nichts. Da fing ich dann an, so rumzuspielen, nur damit da was drinstand, dass der aufhörte zu gähnen. Manchmal stellte ich auch erst mal was rein, was ich schon hatte.
Wir haben nie vorher diskutiert, darüber, wie das werden könnte. Vielleicht weil das Pinas Arbeit zu früh festgelegt hätte. Da sollte, musste ja noch das ganze Abenteuer, die Entdeckungsreise stattfinden.
Wim Wenders: Aber trotzdem interessiert mich das so ein bisschen, wie sich das gegenseitig anschubst.
Peter Pabst: Das klingt jetzt erst mal wie ein Widerspruch. Einerseits hat sich der Prozess der Annäherung an ein neues Stück in den fast dreißig Jahren, die Pina und ich zusammen gearbeitet haben, nicht wesentlich verändert, andererseits hat sich aber nie ein Rezept entwickelt, das eine eindeutige Antwort auf diese Frage zulassen würde.
Wir fingen eigentlich beide unabhängig voneinander an. Dabei bin ich sicher, dass Pina schon genauere Gedanken hatte als ich. Nur hat sie darüber nie gesprochen, vielleicht, weil sie es noch nicht formulieren konnte oder wollte. Sie war ja sehr vorsichtig mit dem gesprochenen Wort.
Wim Wenders: Dann ist es vielleicht besser, wenn wir das nicht allgemein bereden, sondern du so Stück für Stück überlegst, wie da was hin und her gegangen ist.
Peter Pabst: Ich weiß, dass ich mich angeschlichen habe, manchmal mit Bildern, manchmal waren es auch irgendwann schon Modelle, die ich versucht hatte. Das war eine Suche nach kleinen Welten, die vielleicht eine Welt für Pinas zukünftiges Stück und für die Tänzer darin werden konnten. Aber am Anfang war meine Suche immer noch ganz ungezielt, diffus, ein Spiel im Nebel.
Wim Wenders: Aber du musst ja dann irgendwann mal ungefähr gewusst haben, was in die Box rein könnte, und das muss ja auch mit Pinas Ideen irgendwie symbiotisch geworden sein.
Peter Pabst: Ja, natürlich. Es wäre idiotisch gewesen, ein Bühnenbild ohne oder gar gegen Pina machen zu wollen. Aber bei uns war der Anfang nie so formuliert, er war viel spielerischer, viel tastender. Und Pina hatte ja zu Anfang auch nicht so konkrete Ideen. In den ersten fünf Jahren hab ich sie immer gefragt, ob sie schon eine Ahnung hat, wo es hingeht oder wo es hingehen könnte. Dann hab ich fünf Jahre lang die gleiche Antwort gekriegt: „Weißt du, ich versuch immer in mich reinzuhören, aber da ist noch was darüber, es kommt noch nicht heraus.“ Und nach fünf Jahren hab ich aufgehört zu fragen.
Wim Wenders: Dann war es ja vielleicht eher so, dass sie ganz froh war, wenn von dir was Konkretes kam, weil sie sich dann auch ein bisschen daran festhalten konnte.
Peter Pabst: Ja, aber erst später. Am Anfang wollte Pina gar nichts. Ich denke, sie wollte einfach nicht gestört werden. Jetzt, während wir darüber reden, denke ich, sie wollte das, was sie zu Beginn einer Produktion mit den Tänzern suchte oder was sie versuchte zu finden, pur sehen, rein, und nicht schon durch eine Geografie oder die Stimmung dessen, was ich gemacht hatte, gefärbt. Einfach ungestört sehen und prüfen, ob das gut ist. Auf neutralem Boden – schwarzem Tanzteppich. Und ich habe da auch nicht geschubst. Ich habe vielleicht mal einen Gedanken erwähnt oder ihr ein Bild auf den Tisch gelegt, eine Skizze. Aber wenn Pina nicht gleich darauf reagiert hat, habe ich es spätestens am Ende der Probe wieder weggeräumt. Ich dachte, dann ist der Vorschlag nicht gut genug oder sie will jetzt nichts sehen. Ich habe da nie versucht etwas durchzusetzen. Ich fand, eine Idee muss schon so gut sein, dass sie gleich anfängt zu strahlen.
Wim Wenders: Da sind dann unzählige unter den Tisch gefallen.
Peter Pabst: Viele, unendlich viele. Das war wie bei einem üppig gedrehten Film, ein Drehverhältnis von mindestens eins zu zehn oder so.
Wim Wenders: Dann gehen wir alles noch mal von Anfang an durch. Über 1980 haben wir schon geredet, wie war denn das bei Nelken?
Peter Pabst: Bei Nelken ...
Wim Wenders: ... Klassiker!
Peter Pabst: Irgendwann haben Pina und ich über Blumen geredet, über Holland. Da gibt es im Frühjahr diese endlosen Blumenfelder.
Wim Wenders: Aber das sind doch eher Tulpen!
Peter Pabst: Ja, da sind es richtige Tulpenfelder. Die sind aber atemberaubend, ein märchenhaftes Erlebnis, das zu sehen ...
Wim Wenders: Da hast du also riesige Farbflächen ...
Peter Pabst: ... wahnsinnig! Und von einer Intensität und in Farbkombinationen ausgesät, als wären die Farmer alle Maler. Du denkst, du wirst verrückt, ein Rausch von Farben. Pina hat auch von Feldern erzählt, auf denen Nelken blühten. Die hatte sie in Chile gesehen. Und Nelken fand ich spannend, weil diese Blumen in den Sechzigerjahren einen sehr formalen Charakter hatten, bürgerlich korrekt waren. Aus welchem Anlass auch immer, man brachte Nelken mit. Meistens kleine Sträuße, fünf oder sieben Blumen. Und später galten Nelken aus eben diesen Gründen als spießig, obwohl sie eigentlich sehr schöne Blumen sind.
Das haben wir damals zwar noch nicht so als Bühnenbild beschlossen, aber das war zumindest mal als eine Möglichkeit in der Welt. Und dann habe ich mal so was gebastelt, eine verrückte Arbeit, weiß ich noch.
Wim Wenders: Mit Plastikblumen oder wie?
Peter Pabst: Nein, im Modell. Du kannst ja so ein Nelkenfeld nicht zeichnen.
Wim Wenders: Also wie hast du es gemacht?
Peter Pabst: Ich habe Schwämme in kleinste Fitzel gerissen, habe sie auf eine Stecknadel gesteckt, die Stecknadel dann in rosa Farbe getunkt und sie irgendwohin gesteckt, damit sie trocknet. So lange, bis ich ungefähr dreitausend Stück (lacht) hatte. Das war richtig kontemplativ, ich hab eine Woche lang keinen Menschen gesehen und nicht gesprochen. Ich! Und daraus habe ich dann im Modell ein rosa Nelkenfeld gemacht. Aber dann dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen süßlich.
Nun hatte ich kurz zuvor einen Film gemacht mit Tankred Dorst. Den hatten wir an der Grenze zur DDR gedreht. Und da war immer dieser Grenzzaun, in die Tiefe gestaffelt, und dazwischen liefen – an Laufdrähten geführt – halb verhungerte Schäferhunde, die versuchten „Grenzverletzer“ zu schnappen. Schrecklich!
Das fiel mir jedenfalls wieder ein, und ich dachte, vielleicht kann ich ja das Nelkenfeld von Schäferhunden bewachen lassen, wegen der Süßlichkeit. Pina mochte den Gedanken an Hundegebell.
Wim Wenders: ... ja klar.
Peter Pabst: Ich wollte also Laufdrähte rechts und links der Bühne spannen und dachte, ich rufe bei der Polizei an und die geben mir dann zwei Schäferhunde. Die haben ja so schöne, ausgebildete, gut erzogene Hunde. Leider hat mir der zuständige Beamte bei der Wuppertaler Polizei erklärt, dass ich die Hunde von ihnen auf keinen Fall kriege. Warum nicht? „Weil unsere Hunde darauf trainiert sind, dazwischenzugehen, wenn es Krawall gibt. Und wenn unsere Hunde auf einer Bühne laute Musik erleben und tanzende Tänzer, dann ist das für die Krawall, und keiner hält sie mehr zurück.“ Der Mann gab mir den guten Rat, ich solle lieber private Hunde engagieren, möglichst aus kinderreichen Familien.
Wim Wenders: Wo viel Musik gemacht wird.
Peter Pabst: Wo viel Musik gemacht wird und wo die alles gewöhnt sind und (lacht) auf alles gefasst. Ich habe also zwei Schäferhunde mit guten Voraussetzungen gefunden, aber das ging auch nicht gut: Der eine hat auf der Seitenbühne gleich unsere Kinosessel entdeckt, die in „Nelken“ immerzu benutzt werden, weich gepolstert und mit Samt bezogen, und sich sofort auf einen dieser Sessel gesetzt – das war offenbar das Komfortabelste, was er bisher in seinem Hundeleben erlebt hatte –, und er weigerte sich strikt und erfolgreich, jemals wieder von seinem Sessel herunterzukommen.
Wim Wenders: Der war falsch besetzt.
Peter Pabst: Der war falsch besetzt und der zweite war auch falsch besetzt. Der kriegte nämlich einen Nervenzusammenbruch, als die Musik zum ersten Mal laut wurde. Er hat sich hingesetzt und hörte nicht mehr auf zu pinkeln (lacht). Also irgendwie war das nichts. Die machten, was sie wollten, und bellten immerzu, was Pina zu den rosa Nelken eigentlich gemocht hatte, als Idee zumindest. Aber als andauernde Geräuschkulisse war das dann doch sehr anstrengend und wir fanden beide, dass es auch Momente im Stück geben müsste, in denen kein Hund bellt. Und so ist das dann entstanden, dass wir schließlich vier Hunde hatten, die aber von ihren Besitzern geführt wurden.
Wim Wenders: Schön, wie so eine Idee sich weiterentwickelt.
Peter Pabst: Ja, das lebt. Deswegen ist es ja so schwer, die Frage klar zu beantworten: wie entsteht denn das oder wie fängt das an?
Wim Wenders: Und dann mussten die Tänzer lernen sich in den Nelken zu bewegen?
Peter Pabst: Dann mussten sie lernen in den Nelken zu tanzen. Das war wieder mal nicht einfach! Aber dafür mussten die Nelken ja erst mal her.
Ich hatte ein sehr kleines Budget für das Stück. Kunstblumen konnte man in Deutschland zwar kaufen, aber nur für viel Geld. Und Nelken gab es gar nicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sie galten als spießig, keiner wollte Nelken kaufen, schon gar nicht künstliche, und also wurden sie auch nicht hergestellt.
Ich hatte mir aber ausgerechnet, dass ich für die Wuppertaler Bühne ungefähr achttausend Blumen brauchen würde. Die gab es nicht am Markt, die konnte ich nicht bezahlen und bis zur Premiere hatte ich noch vier Wochen Zeit. Grund genug, um schlecht zu schlafen! Um fünf Uhr morgens bin ich aufgewacht, in Schweiß gebadet, und dachte panisch darüber nach, wo in der Welt noch jemand Kunstblumen macht. Und plötzlich – das war wie ein Flash – sah ich fleißige gelbe Hände, die Blumen machten. Mensch, natürlich, in Asien!
Fieberhaft habe ich dann Telefonnummern rausgesucht, bis neun Uhr gewartet und dann die Wirtschaftsabteilungen aller asiatischen Botschaften in Bonn angerufen. „Werden in Ihrem Land Kunstblumen hergestellt?“
Bei der thailändischen Botschaft hatte ich Glück. Die haben mir einen Kontakt nach Hamburg vermittelt und zu einem Hersteller in Bangkok. Herr Rumpf, der Hamburger Importeur, rief mich nach ein paar Stunden zurück und bot an, achttausend Nelken in drei Farbtönen herzustellen und in zwanzig Tagen per Luftfracht ins Opernhaus Wuppertal zu liefern.
Daraus ist fast eine Freundschaft geworden, weil der uns über lange Zeit immer mit Blumen versorgt hat. Er hatte einen alten Chinesen, der in der Konfektion war – der machte, nehme ich an, Jeans und T-Shirts –, aber der hatte früher mal Kunstblumen hergestellt, und immer, wenn ich mit einer Bestellung kam, dann sattelte der um und produzierte rosa Nelken für uns und später auch andere Blumen.
Wim Wenders: Und immer gleich achttausend Stück?
Peter Pabst: Nein, das ging auch mit zweitausend. Jedenfalls hab ich die Blumen erst mal gekriegt, ich habe sie auch schnell genug gekriegt und für einen Preis, den ich bezahlen konnte. Das war schon fast ein Wunder. Aber als sie zum ersten Mal eingepflanzt waren, da war es dann wirklich wunderbar, dieses rosa leuchtende Feld aus Nelken auf der Bühne der Wuppertaler Oper, gar nicht süßlich, einfach ein Traum.
Doch dann kam sofort ein böses Erwachen: Die gehen ja kaputt, wenn die Tänzer darin tanzen!
Wim Wenders: Ja klar ...
Peter Pabst: ... und das habe ich bis heute nicht vergessen, dafür habe ich Pina wirklich geliebt, weil da hat sie gezeigt, wie sehr sie es einem leicht gemacht hat, zu spinnen – auch mit Bühnenbildern. Da hat sie nämlich gesagt: „Wir können ja eine Szene machen, wo die alle Nelken trösten.“ Sie nannte das „Nelkentrösten“, das hieß, die geknickten Nelken wurden wieder aufgerichtet (lacht). Das habe ich ihr nie vergessen, dass Pina meine Nelken trösten wollte. Wir haben das dann aber nicht gemacht, weil sich herausstellte, dass auch der Verfall wieder schön war. Das hat ja eine unglaubliche ästhetische Wirkung, wenn dieses Nelkenfeld am Anfang ganz warm glüht. Und dann gibt es diesen Moment – das ist wie so ein Nachbrenner –, wenn Lutz Förster in einer Taubstummensprache The Man I Love erzählt oder tanzt und plötzlich das volle Licht angeht und dann die ganze Bühne in gleißendem Rosa erstrahlt. So haben wir dann irgendwann gemerkt, dass es ja auch eigentlich schön ist, dass die kaputtgehen, dass die Blumen einfach zertreten werden. Entschuldige, ich rede wahrscheinlich zu viel ...
Wim Wenders: ... nein ist wunderbar, das wollte ich immer schon wissen.
Peter Pabst: Lass mich noch was zu dem „Nelkentrösten“ sagen. Das ist so ein kleines Beispiel für die freie, komplizierte und doch ganz leichte Fantasie, die Pina bei ihrer Arbeit hatte. Das war einzigartig. Und so ging sie mit Schwierigkeiten um, nicht beschwert oder klagend, sondern einfach erfinderisch. Sie beseitigte Schwierigkeiten, indem sie sofort etwas daraus machte. Nelken trösten!
Und nachdem ich so viel über Unsicherheiten gesprochen habe, fällt mir nun auf, dass da ja doch eine große Sicherheit war. Was immer ich für ein Bühnenbild gedacht oder gemacht haben mochte, ich konnte sicher sein, dass Pina und die Tänzer es ganz wunderbar benutzen würden, es auf die schönste Art zu ihrer Welt machen würden. Was für eine Freiheit hat das dem Bühnenbildner gegeben. Vielleicht ist das auch ein Teil der Symbiose. Ich habe das Bühnenbild für sie gemacht und sie haben mich davon befreit, indem sie es übernommen haben.
Das Nelkenfeld hat dann auch noch einen Nebeneffekt gehabt, wie in Amsterdam zum Beispiel. Da haben wir Nelken gespielt, und am Morgen nach der Premiere saßen vor dem Theater lauter Bühnenarbeiter, aber solche mit kaputten Zähnen und gebrochenen Nasenbeinen und dramatischen Tätowierungen – das war damals noch nicht ganz so üblich wie heute –, die saßen in der Sonne und machten rosa Nelken gerade. Auf der Straße, an einer Gracht! Das war ein herrlich absurdes Bild: Diese wüsten Männer, vor denen man sich fürchten mochte, machten rosa Nelken gerade.
Wim Wenders: Ist da Draht drin?
Peter Pabst: Da ist Draht drin.
Wim Wenders: Keine Gefahr für die Tänzer?
Peter Pabst: Doch, könnte sein. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Ich habe schon sehr über den Boden nachgedacht, um einen zu kriegen, in den ich die Nelken so reinstecken kann, dass sie nicht bei der ersten Berührung wieder rausfliegen. Je mehr lose auf dem Boden herumliegen, desto größer ist immer die Verletzungsgefahr. Das ist dann schon wieder ein relativ komplizierter Boden geworden: Holzplatten mit Löchern, unterlegt mit einem faserigen Dämmmaterial, das man damals für Wärme- oder Schallisolierung beim Hausbau benutzte.
Wim Wenders: Das ist ein bisschen weicheres Material?
Peter Pabst: Das ist ein weicheres Material, ja. Heute sind es meistens Schäume, aber damals hat man noch so Faserdämmplatten gemacht. Das war wie gepresste Kokosfasern oder so ...
Wim Wenders: ... so Schalldämpfdinger wie an deiner Decke hier?
Peter Pabst: Genau. Die erfüllten zwei Funktionen: Erstens hielten diese Fasern die Blumenstiele ganz gut fest, und zweitens machten sie den Boden schalltot, das heißt, der Holzboden berührt nicht mehr den Bühnenboden und macht nicht mehr so einen ekligen Bums ...
Wim Wenders: Wir machen mal weiter. Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört – was hast du denn da für ein Feld ausgebreitet?
Peter Pabst: Das war angestoßen von einem Foto, wie so oft. Ich muss mal überlegen ... es könnte eins von Diane Arbus gewesen sein, ich bin nicht sicher. Also ich hatte ein Foto gefunden, darauf war einfach ein Waldrand, ein Tannenwald im Nebel. Erde und Nebel. Schwere Erde, ein Acker, der jeden Tag umgegraben wurde. Dann hab ich aber gedacht, so ist das nichts, und habe den Acker auf eine leicht in sich verzogene Schräge gehoben, die man zwar mit den Augen kaum wahrnimmt, die aber noch eine andere Spannung in das Bild bringt. Von vorne nach hinten steigt der Boden links zwanzig Zentimeter und rechts dreißig Zentimeter an. Die Schräge ist also in sich verzogen, aber minimal, nicht sichtbar, aber fühlbar.
Wim Wenders: Für die Tänzer wahrscheinlich doch ganz schön schräg.
Peter Pabst: Nein, das merken die kaum. Diese Schräge ist circa zwei Prozent. Eine normale Bühnenschräge, auf der die Tänzer ohne Probleme tanzen können, ist drei bis 5,5 Prozent. Natürlich haben mich alle schief angeguckt und nicht verstanden, warum ich sie so eine riesige Schräge aufbauen lasse, die man eigentlich gar nicht sieht. War ja ein großer Bauaufwand. Aber als ich sie für eine Probe einmal weggelassen habe, weil die Einrichtungszeit so knapp war, und die Erde einfach auf den Bühnenboden habe schaufeln lassen, da war das, als wenn dir jemand unerwartet die Ohren zuhält. So hat das gefehlt, so langweilig, so unbefriedigend wirkte das. Es ging überhaupt nicht ohne, das war jetzt allen klar, aber es blieb ein in jeder Hinsicht schwerer Boden.
Wim Wenders: Hat der an den Füßen geklebt?
Peter Pabst: Manchmal schon. Das war immer so eine Grenzgängerei, wie feucht man ihn hält, damit er nicht staubt, und wie trocken er sein muss, dass man nicht ausglitscht oder dass die Erde nicht wirklich klebt. Es ist für die Tänzer in jedem Fall schwer, weil der Boden unregelmäßig ist. Die Erdbrocken müssen schon grob und fest sein. Die merkt man deutlich unter den Füßen. Und dann ...
Wim Wenders: Dann hast du ...
Peter Pabst: ... dann habe ich irgendwann mit Nebel rumgespielt.
Wim Wenders: Ja, der Nebel, reden wir mal über den Nebel.
Peter Pabst: Da mache ich vielleicht zuerst mal wieder einen Umweg: In den Siebzigerjahren habe ich das Bühnenbild und die Kostüme gemacht für Peter Zadeks Bochumer Inszenierung von Hamlet. Der fand in einer umgebauten Fabrikhalle statt. Das war ein sehr poetischer, aber ein rau poetischer und sehr brüchiger Hamlet. Magdalena Montezuma spielte den Geist von Hamlets Vater. Ich hatte ihr einfach eine Kiste hingestellt und einen barocken goldenen Spiegelrahmen davorgeschraubt. Magdalena setzte sich auf die Kiste in den Rahmen und war das Bild von Hamlets Vater. Und immer, wenn der Geist erschien, stieg sie von der Kiste aus ihrem Rahmen, und ich kam mit meiner Nebelmaschine und machte ihr eine Wolke (lacht). Das war ihre Geisterscheinung. So schritt sie immer in einer Wolke und ich immer zischend und puffend neben ihr her.
Mir ist das eingefallen, weil da ein Empfinden war, in dem sich Pina und der Peter Zadek – die sich übrigens beide sehr geschätzt und auch gemocht haben – ganz ähnlich waren. Auf eine bestimmte Art haben beide sehr einfach gedacht. Das hatte etwas mit Ehrlichkeit auf der Bühne zu tun. Mit nicht schummeln. Hier hieß das: im Theater wird Nebel – wenn er nicht aus Tüll ist – mit einer Nebelmaschine gemacht. Da ist ein Mensch, der hat so eine Maschine, drückt auf einen Knopf, und aus einer Düse kommt mit lautem Zischen ein scharfer Strahl, man muss wohl sagen „Dampf“. Dieser Dampf wird zu einer Wolke, breitet sich weiter aus und hüllt die Menschen auf der Bühne in Nebel. Und wenn das so ist, so fand die Pina ebenso wie der Zadek, dann kann man das auch sehen!
Es hat Pina – jedenfalls während unserer Zusammenarbeit – nie interessiert, mit großem technischem Aufwand zu verstecken oder zu verheimlichen. Die Wirklichkeit war auch eine Wahrheit auf der Bühne. Wenn im Frühlingsopfer die Tänzer sich so sehr anstrengten, dass sie keuchten und schwitzten, und wenn sie sich dann in den Torf auf der Bühne warfen, dann wurden sie eben „schmutzig“. So wie ich in Zadeks Othello den Ulrich Wildgruber schwarz angemalt habe, und als die weißhäutige Eva Matthes als Desdemona sich verliebt in seine Arme warf, dann wurde sie eben auch schwarz. Weder Pina noch Zadek hatten Sorge, dass das unfein sein könnte. Zum Glück unserer Zusammenarbeit gehörte ganz sicher, dass wir diese Sorglosigkeit von Anfang an geteilt haben. Keiner von uns musste fein sein, keiner wollte dekorativ sein und keiner von uns hat sich für Technik interessiert.
Ich kann das, aber ich brauche es nicht.
Wim Wenders: Die Nebelmaschine, wer hat die dann benutzt? Die Tänzer selbst?
Peter Pabst: Nein, die Nebelmaschine habe lange Zeit ich in der Hand gehabt. Die war wie ein Pinsel für mich und ich habe damit in die Luft gemalt, ziemlich expressiv manchmal, ich habe Tänzer versteckt oder auch verschreckt, habe Tanzreihen mit Nebel unterbrochen, ganz verschwinden und wieder auftauchen lassen. Das hat viel Spaß gemacht und es sind wunderbare Bilder entstanden und ständig wechselnde Stimmungen, die von absolut romantischen Momenten bis zum totalen, bedrohlich wirkenden, beängstigenden Chaos reichten.
Später dann, als auch der Nebel seine Form gefunden hatte, hat es ein Kollege von der Requisite gemacht.
Wim Wenders: Two Cigarettes in the Dark: Da hast du ein unmögliches, aus allen Proportionen fallendes Haus gebaut. Verrücktes Teil. Was war denn das, wo kam denn das Haus her?
Peter Pabst: Das ist erst mal aus der Verzweiflung entstanden. Irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, die Böden waren abgegrast (lacht), und ich wusste nichts mehr über Böden zu dem Zeitpunkt. Also Boden konnte grad nicht sein.
Ich habe nach einem Raum gesucht, hab mit Pina über Räume geredet. Sie hatte verstanden, dass ich keinen Boden mehr denken wollte oder konnte, und schien das gleiche Bedürfnis nach einem Raum zu haben. Ich weiß nicht mehr, was den Anstoß gegeben hat da. Vielleicht war das ein Bild von einem Museumsraum, deshalb die großen Fenster. Die ja sind wie Schaufenster. Während ich an dem Raum gezeichnet habe, ist er für mich so etwas wie ein verrücktes „Hotel New Hampshire“ geworden. Die Türen sind zu klein oder zu groß, man versteht auch nicht, wo die hinführen, und die Menschen darin sind alle ein bisschen verrückt oder benehmen sich jedenfalls so.
Wim Wenders: Ja, es hat auch so ein bisschen was vom deutschen Expressionismus. Da ist alles außer Proportion.
Peter Pabst: Ja, total ...
Wim Wenders: ... auch das Verhalten der Leute.
War das die erste Projektion, die du benutzt hast ? Diese Super-8-Bilder auf die nackte Brust von – ich glaube, das war Helena.
Peter Pabst: Ja, das war Helena. Das haben sie auf den Proben ausprobiert und Pina hat es dann im Stück behalten.
Wim Wenders: Für mich – so in der Erinnerung – war es das erste Mal, dass bei Pina etwas projiziert wurde.
Peter Pabst: Vorher hatte Pina in Walzer den Film einer Geburt auf einer kleinen Leinwand gezeigt.
Aber zurück zu dem Raum. Ich habe dann einfach gebaut und dieser Raum ist mir so geraten. Hinter die Fenster wollte ich andere Landschaften setzen. Die wurden dann wie eigene Bühnen.
Wim Wenders: Auch so komische Treppen ...
Peter Pabst: ... Treppen, die architektonisch ganz unsinnig sind, sinnlos zwischen Ebenen rauf und runter steigen ... Und hinter den Fenstern sind wieder Bühnenlandschaften, ein Dschungel hinter einem Fenster, eine Wüste hinterm anderen – da taucht übrigens schon ein Kaktus auf –, und links ...
Wim Wenders: ... das sieht fast so wie ein Aquarium aus ...
Peter Pabst: ... hinter dem anderen links war ein Aquarium, genauer gesagt drei, in die ich dann Goldfische reingesetzt hab. Das war eher kompliziert. Ich hab mir die immer von einem Züchter geholt. Jeder in seinem Plastikbeutel mit Wasser und dann musste ich die Plastikbeutel in das Aquarium legen, damit sich das Wasser im Beutel ganz langsam der Temperatur des Aquariums angleicht. Erst dann konnte man sie aus dem Beutel rauslassen und es ging ihnen gut. Dabei hab ich übrigens auch gelernt, dass Fische von Natur aus gar nicht scheu sind. Ich konnte die streicheln! Die kannten uns Menschen noch nicht.
Später ist Dominique Mercy in weißer Unterhose und mit Schwimmflossen zu den Goldfischen ins Wasser gestiegen.
Wim Wenders: Gut. Ich schwimm auch gerne mit Fischen rum. Ich habe einen Freund, der hatte seinen Swimmingpool mit frischem fließendem Wasser gefüllt und da waren Fische drin, damit man auch immer wusste, dass kein Chlor und kein gar nichts drin war. Die Fische fühlten sich sauwohl und waren eigentlich so wie Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, die waren immer froh, wenn jemand dazukam ...
Peter Pabst: ... dann hatten sie Gesellschaft, sind nicht nur Delphine so neugierig ...
Wim Wenders: Sag mal, Viktor: da wird alles Mögliche raus- und reingeschleppt. Da kannst du gleich mehrere Bühnen mit dekorieren mit alldem, was da rein- und rauskommt. Bist du auch zuständig für alle Requisiten und alles, was auf der Bühne gebraucht wird?
Peter Pabst: Grundsätzlich ja. Aber das heißt nun nicht, dass ich jedes Möbel und jedes Requisit erfinde oder gar entwerfe. Marion Cito kümmert sich sehr darum, Marion, die unsere Tänzer so wunderbar anzieht.
Viele dieser Dinge finden sich schon sehr früh in den Proben. Dann besorgen sich die Tänzer Requisiten, die sie für ihre Erfindungen brauchen, direkt bei Jan Szito oder Alf Eichholz, den beiden Requisiteuren. Dass wir in unserer kleinen Compagnie gleich zwei Requisiteure haben, zeigt schon, wie wichtig das ist für das Entstehen des Materials für die Stücke. Wenn die Tänzer etwas ausprobieren wollen und dafür irgendwelche Gegenstände brauchen, dann müssen die schnell bereitstehen, sonst ist die Situation schon wieder vorbei.
Oft bleiben die Dinge so, wie sie auf den Proben waren. Manchmal denke ich aber auch, sie könnten oder müssten anders aussehen aus ästhetischen oder praktischen Gründen oder auch aus Gründen der Sicherheit. Dann ändere ich sie, fange an zu entwerfen. Aber ganz oft spielt bei diesem Thema der Mangel an Zeit mit. Bei den Bühnenproben zu Viktor wollte Pina eine Szene wie eine Versteigerung machen und so was muss dann oft innerhalb weniger Minuten entstehen. Da kann man gar nicht lange darüber nachdenken: wie müsste das denn aussehen?
Das hat einen großen, für mich fast erzieherischen Wert, weil das oft zu ganz unprätentiösen Lösungen führt. Die würde ich mich als Designer gar nicht trauen, aber es ist genau das, was jetzt gebraucht wird.
Nicht gestaltend eingreifen ist manchmal erfrischender und lebendiger als das schönste Design.
In Viktor ist das dann eine ziemlich wirre Mischung geworden aus Antiquitäten, Banalitäten und vielem anderen ...
Wim Wenders: ... unglaublich viele Möbel.
Peter Pabst: Ja, ganz viele Möbel. Die sind fast alle aus Die Sieben Todsünden, weil die gerade greifbar waren ... und eigentlich die einzigen „schönen“ Möbel, die wir haben.
Wim Wenders: Doppelt verwendet, wa?
Peter Pabst: Wir können nur kaufen oder unsere eigenen Sachen nehmen. Ausleihen geht nicht, weil wir die Sachen zu lange entführen, wenn wir auf eine weitere Tour gehen oder so.
Wim Wenders: Was stand denn da im Hintergrund? In meiner Erinnerung sind das so pyramidenähnliche Inkabauten links und rechts. Was sind das für Gebilde?
Peter Pabst: Wo?
Wim Wenders: In Viktor, da stehen links und rechts so ansteigende ... ja, was ist denn das?
Peter Pabst: Ich habe das nie als Bauten gesehen. Da sind Wände aus Erde. Ich habe für mich nur nie geklärt, ob das jetzt eine Grube ist, also ob die wirklich da oben ist, oder ob das Erdwälle sind, also die Wirklichkeit unten auf der Bühne. Das wusste ich nie genau.
Wim Wenders: Ah, ja!
Peter Pabst: Das war das erste Mal, dass wir diese Art von Koproduktion gemacht haben.
Wim Wenders: Damit habt ihr das eingeführt?
Peter Pabst: Ja.
Wim Wenders: Mit den Römern!
Peter Pabst: Ich glaube, manche im Publikum waren enttäuscht über das Bühnenbild, weil die abgebrochene Säulen oder so was erwartet haben. Aber die gab es nicht. Nun war es Erde und da oben ging immer der Jan Minarik mit einer Schaufel rum. Dem habe ich vor jeder Vorstellung Tonnen von Erde hochschaffen lassen, damit er dreieinhalb Stunden lang die Erde wieder runterschaufeln konnte.
Wim Wenders: Der musste schwer schuften.
Peter Pabst: Ja, das war wirklich ein arbeitsintensives Bühnenbild.
Am Abend des ersten Aufbautages sah es grauenhaft aus, die Teile waren vom Transport zerschunden, sie waren als einzelne Bauteile sichtbar, überall weiße Flecken und Brösel. Grauenhaft! Zum Weinen. Ich war entsetzt und unsäglich enttäuscht. Pina machte mitleidig den Vorschlag, ich könnte doch ein Drittel wieder abräumen, alles mit diesen rot-weißen Plastikbändern absperren und eine Baustelle daraus machen. Was eigentlich ein guter Einfall war. Ich hab aber ziemlich giftig reagiert und ihr entgegnet, dass ich das Bild erst einmal richtig fertig machen wollte. Wenn sie es dann immer noch vorziehen würde, würde ich ihr gerne die Baustelle einrichten.
Am nächsten Tag haben wir dann sorgfältig den Aufbau verbessert und zum Abschluss habe ich den ganzen Bau mit Leim spritzen und dann mit frischer Erde bewerfen lassen. Das Ergebnis war umwerfend. Wie brauner Samt schimmerte die Erde im Licht. Der riesige dunkle Raum war wie ein warmer Mantel für die Tänzer. Er beschützte sie. Wir haben das dann nach jedem Aufbau wieder gemacht: mit Leim bespritzt und mit Erde beworfen. Wie du gesagt hast: schwere Arbeit. Ein Wahnsinn! So lange, bis nach etwa siebzehn Jahren die Teile so schwer geworden waren, dass niemand sie mehr heben konnte und wir das Bild neu bauen mussten. Aber ich finde, das Bild hat diesen sorgfältigen Aufwand verdient und noch viel mehr hat es Pinas Stück verdient. Für mich ist Viktor immer noch eines der vielfältigsten und reichsten Stücke in ihrem Werk.
Aber dieser Bühnenraum war später nicht nur voll von Leben erfüllt, er lebte auch selbst. Der große, anfangs samtene saubere Raum wuchs immer ein bisschen weiter zu. Durch Jan, der unablässig diese Unmengen von Erde von oben herunterschaufelte und auf den Bühnenboden warf.
Wim Wenders: Danach wurde es richtig schräg, also Ahnen mit den Kakteen auf der Bühne. Was waren denn das für Dinger? Wie hast du die gemacht? (Lacht.)
Peter Pabst: Ich glaub, ich hatte da ein Foto von einer Kakteenlandschaft gefunden, nicht mal besonders schön, eigentlich eher ein bisschen langweilig. Nur mag ich diese großen Kakteen so gerne. Ich habe immer davon geträumt, ein Haus zu haben in der Wüste von Arizona, ein einfaches Holzhaus, aber da müssten mindestens drei große Kakteen davorstehen, any how ... – Pina mochte den Gedanken an Kakteen auch, aber richtig schräg wurde es eigentlich erst, als ich angefangen habe, die zu machen. Fing schon beim Modell an: wie macht man Kakteen in Klein? Die sollten ja irgendwie auch lebendig sein. Klar kann man sich hinsetzen und sie schnitzen, aber dann werden sie formal immer gleich steif. Es fehlt der Raum für Unregelmäßigkeiten. Das ist so ein Grundproblem der Formen, ja schon der Materialien bei kleinen Maßstäben im Modell. Ich kann die Eigenschaften der Materialien, wie Flexibilität, Elastizität, Beweglichkeit, spezifisches Gewicht oder Oberflächenstruktur, nicht auch im Maßstab 1:25 verkleinern. Also sind sie fast immer zu dick, zu schwer, zu spröde oder zu steif. Und alles das spricht gegen Leben im Modell.
Ich wollte aber „lebendige“ Kakteen! Ich hab Kakteen immer als Figuren gesehen, fast wie Menschen ...
Wim Wenders: ... vor allem die mit den angewinkelten Armen dran ...
Peter Pabst: ... das sind so ganz typische Dinger. Jedenfalls hat sich Pina gerade mal wieder Kuchen holen lassen aus ihrem Lieblingscafé – das Café Best an der Ecke war ein ganz traditionelles Café mit eigener Konditorei –, und da ist es mir eingefallen, ich bin rübergegangen und habe gefragt, ob ich von ihnen eine Tortenspritze haben kann – Konditoren haben doch diese Plastikschläuche oder Beutel, weißt du, mit vorne so ’ner Spritze dran, mit so Zähnchen ...
Wim Wenders: ... richtig ...
Peter Pabst: ... und damit machen die diese gedrehten Tupfer aus Buttercreme auf ihre Torten ...
Wim Wenders: ... und Spritzgebäck!
Peter Pabst: Ein gutes Stichwort! Ich habe einfach Gips angerührt statt Buttercreme – gleiche Konsistenz – und habe mit deren Tortenspritze Kakteen „gespritzt“ – Spritzkakteen – und musste nur noch warten, bis sie hart waren.
Wim Wenders: Für dein Modell?
Peter Pabst: Für mein Modell. Ganz lebendige Formen. Die Erinnerung daran freut mich heute noch, weil dieser Einfall so naiv war, und das ist wieder ein Thema. Naivität ist wichtig! Weil man sich mit all seiner Professionalität so viele Türen zugemacht hat.
Pina hat mal einen sehr klugen Satz gesagt, der trifft das genau: „Für alles, was man lernt, verliert man auch etwas.“
So sind die Kakteen also im Modell entstanden, und ich glaube, in diesem Fall haben wir gar nicht lange gezögert, das war schnell entschieden.
Diese merkwürdige Welt sollte es sein. Und das war auch gut so, denn das Allerschrägste an diesem Abend war ja schon das Stück selber. Und dass wir es so rasch entschieden haben, war auch gut, weil ich wollte schon so fünfzig bis sechzig Stück haben – zwischen vier und sechs Meter hoch –, und dafür war es dann eigentlich auch schon wieder zu spät. Das Bild sollte aber stark sein, so wie Arizona.
Wim Wenders: War das eine Koproduktion?
Peter Pabst: Nein, das war einfach Wuppertal ... und dann haben die technische Leitung und die Werkstätten sich lange gesträubt, weil es so spät für sie war – das war inzwischen schon fast eine Tradition geworden –, bis schließlich der Leiter der Werkstätten – Leo Haase war das damals – sagte: „Wenn morgen Früh um sieben die ersten Zeichnungen beim Pförtner liegen, fang ich an.“ Ich hab dann über Nacht drei Kakteen gezeichnet, so, wie ich fand, dass sie sein sollten, und die Werkstätten haben sie mir als Muster gebaut, damit wir Erfahrungen machen und sie besprechen konnten. Die Muster waren aber zum Glück schon so gut, dass wir sie nehmen konnten. Inzwischen hatte ich die anderen gezeichnet und die Werkstätten haben weitere fünfzig Stück gebaut.
Wim Wenders: Aus was?
Peter Pabst: ... aus Holz, Stahl, Styropor und kaschierten Oberflächen, für das Theater ganz klassische Materialien. Ich habe ein sehr genaues plastisches Formempfinden und meine Bühnenbilder für Pinas Stücke sind ja fast alle große Skulpturen: Viktor, Ahnen, O Dido, Wiesenland, Rough Cut, Ten Chi oder Vollmond – bei allen bin ich in der Technik und in der Materialentscheidung immer sehr konservativ geblieben. Das hat einmal mit meinem Formempfinden zu tun, aber auch mit einem wunderbaren Freund und Theaterbildhauer, Herbert Rettig, mit dem ich alle diese Arbeiten realisiert habe.
Wim Wenders: Haben die Dinger Stacheln?
Peter Pabst: Da „piekst“ du aber in etwas rein! Bis dahin hatten sie keine Stacheln. Ich hatte immer gedacht, das ist aber blöd ...
Wim Wenders: ... ja eben ...
Peter Pabst: ... ein Kaktus ohne Stacheln ist ja nicht wirklich ein Kaktus. Aber Stacheln woraus? Also suchen. Und die Suche wurde wieder eines dieser wunderbaren Wuppertaler Erlebnisse ...
Wim Wenders: (Lacht.)
Peter Pabst: ... weil über Wuppertal immer so viel Hässliches geredet wird, langweilig, fade, nichts los und so ... das sieht vielleicht so aus an der Oberfläche, aber dahinter findest du immer irgendwelche Überraschungen. Ich bin also herumgefahren und habe nach irgendwas gesucht, was sich in Kakteenstacheln verwandeln ließe. Auf dieser Suche hat mich meistens der Leo Haase begleitet.
Der kannte viele der geheimen Ecken von Wuppertal und wir waren befreundet. Jedenfalls kamen wir irgendwann zu einem Platz – ich würde das heute nicht mehr finden, muss auf der anderen Seite vom Tal gewesen sein, Richtung Varresbeck oder so –, da standen unter Bäumen eine alte Fabrikationshalle und ein Bürogebäude, beides ganz klein, und da war eine Frau so Ende sechzig in einem geblümten Kittel mit grauen Wollhandschuhen, komisch, dass ich das heute noch weiß, Wollhandschuhen mit so abgeschnittenen Fingern. Das Ganze sah aus, als wenn du einen Film in den Dreißigerjahren drehen würdest. Zwei Männer, wie Lagerarbeiter, die hatten diese grauen langen Kittel an, Wollhandschuhe und eine Schiebermütze auf dem Kopf. Die machten Besen zum Straßenkehren ...
Wim Wenders: Ah ja!
Peter Pabst: ... und ich war natürlich interessiert an dem Material für die Borsten. Das konnte ich bei denen als Rohmaterial kaufen, etwa eineinhalb Meter lange Bündel aus Nylonstangen, circa einen bis eineinhalb Millimeter dick.
Wim Wenders: Das, was früher mal Reisig war, oder?
Peter Pabst: Das waren nun Nylonborsten ...
Wim Wenders: ... und die habt ihr reingesteckt.
Peter Pabst: Ja, aber nicht gleich. Erstens waren diese Nylonborsten so widerstandsfähig, dass ich sie zunächst gar nicht kaputt gekriegt habe. Musste sie ja in kurze Stücke zerschneiden für die Stacheln. Und zweitens, als ich in die Werkstätten kam und das Wort Stacheln nur aussprach, haben sie mich für total verrückt erklärt, da bin ich nur knapp einer Einweisung entgangen. Sie haben natürlich gleich verstanden, dass wir da über Abertausende von Stacheln geredet haben. Und dazu fehlte die Zeit.
Mir wurde klar, dass da nur ein Präzedenzfall helfen konnte. Ich habe mich am Abend versteckt und mich über Nacht ins Theater einschließen lassen. Dann habe ich eine Nacht lang gearbeitet und habe einen Kaktus mit Borsten versehen, also Löcher gebohrt und diese Stacheln da reingeleimt.
Wim Wenders: Richtig gebohrt?
Peter Pabst: Na ja, Löcher in den Kaktus reingepiekt und dann immer ein kleines Bündel Stacheln da reingesteckt. Ich dachte, wenn da am Morgen ein Kaktus mit Stacheln steht, gibt es keinen Weg zurück.
Das haben sie am nächsten Morgen um sieben auch sofort verstanden. So einen Krach habe ich selten gehabt in dem Theater. Und dann passierte eines der schönsten Theaterwunder in meiner ganzen Zeit ...
Wim Wenders: ... mich wundert nichts mehr.
Peter Pabst: Na ja, das Problem hatte sich herumgesprochen, und dann kamen irgendwann alle, nicht nur Handwerker, egal ob Schlosser, Schreiner, Maler, Bühnentechniker oder Beleuchter, sondern auch aus der Verwaltung und aus der Dramaturgie, alle. Wer immer zwanzig Minuten Zeit hatte, kam Stacheln reinstecken in diese Kakteen. Das ganze Theater fühlte sich zuständig und die Kakteen wurden immer stacheliger. Das war wirklich zauberhaft.
Wim Wenders: Die musstet ihr dann aber wie eure Augäpfel hüten, diese Kakteen?
Peter Pabst: Ja, das ist ein anderes Thema. Ich wünsche mir das sehr, dass sie entsprechend ihrer Kostbarkeit behandelt werden. Das sind ja wirklich Kostbarkeiten, materiell wie ideell.
Aber das war noch nicht das Ende. Ich fand dann die Stachelbüschel zu gerade ...
Wim Wenders: ... oh, was geht jetzt los!?
Peter Pabst: ... die sahen nicht wirklich echt aus, so gleich und parallel. Ich habe überlegt, was man da nun wieder machen kann, und dachte: vielleicht sind die hitzeempfindlich. Also hab ich mir so einen Heißluftfön besorgt, mit dem man sonst Lackfarbe abmacht. Und siehe da, in dem Strom der heißen Luft machten die Stacheln „pitsch“ und schossen in allen Richtungen auseinander.
Wim Wenders: Super.
Peter Pabst: Und dann hab ich stundenlang Kakteen gefönt – ein Kakteenfriseur!
Wim Wenders: Passt ebenfalls zur Schrägheit des Stückes.
Peter Pabst: Ja.
Wim Wenders: Wenn wir zum nächsten Stück gehen, hat’s danach richtig gerumst (lacht). Das war so ein weiteres ...
Peter Pabst: ... was war das nächste?
Wim Wenders: ... unmögliches Ding, weil dann in Palermo Palermo die Mauer einstürzte ... da wurdest du wahrscheinlich endgültig für verrückt erklärt.
Peter Pabst: Ja, na da wurde der Widerstand ernster ...
Wim Wenders: Habt ihr das statisch ergründet, das mit der Mauer? Wie kam das überhaupt dazu? Man schmeißt ja nicht so schnell mal ’ne Mauer um ...
Peter Pabst: ... ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Also das war im Herbst 1989.
Wim Wenders: Ah ja, da fielen ja einige Mauern um.
Peter Pabst: Was insofern ein Problem war, als niemandem mehr klarzumachen war, dass „unser Mauerfall“ nichts zu tun hatte mit dem in Berlin.
Wim Wenders: Klar.
Peter Pabst: Das war wirklich im Herbst 89! (Lacht.) Aber wir waren vierzehn Tage früher. Es war wieder eine Phase der Verzweiflung. Wir kamen nicht weiter. Pina war verzweifelt, ich war verzweifelt. Ich hatte schon viele Sachen für das neue Stück probiert, unter anderem einen blühenden Obstgarten. Es war alles sehr hübsch, aber eben auch nicht mehr. Das weiß man ja auch selber, dass etwas eigentlich nicht das ist, was es sein sollte. Also Pina und ich saßen alleine in der Lichtburg, in der Pause zwischen zwei Proben, und diese Lichtburg, die kennst du ja, ist ein ehemaliges Kino aus den Fünfzigerjahren.
Wim Wenders: Richtig, ja.
Peter Pabst: Und wie Kinos früher waren, in den Fünfzigerjahren, sind die Wände mit so gewellter Kunststofffolie verkleidet – Acella hieß das –, und in der Lichtburg ist diese Verkleidung an manchen Stellen inzwischen zerrissen, und dahinter sieht man das nackte Mauerwerk. Und in dieses Schweigen der Verzweiflung sagte Pina mit einem zaghaften Lächeln: „Guck mal, das sieht aus wie eine Mauer hinter einem Vorhang“ ... Schweigen ... vielleicht zehn Minuten lang ... Dann sagte ich: „Wir könnten ja ’ne Mauer machen.“ ... „Wie denn?“, fragte Pina nach weiteren zehn Minuten. Ich: „Wir können das Portal zumauern.“ ... Schließlich sagt sie: „Und wie sollen wir die wieder wegkriegen?“... Ich habe nachgedacht: „Wir können sie umschmeißen.“ Pina hat einen Moment überlegt, dann sagt sie: „Du, ich glaube, das mag ich nicht. Wenn ich an dieses Geräusch von dem Styropor denke, das da fällt, ich glaube, das mag ich nicht.“ ... Und dann habe ich gesagt: „Ich meine ’ne echte Mauer ...“ Und dann kam wieder ein langes Schweigen. Nach vier, fünf Minuten schaut mich Pina an und sagt: „Du bist verrückt!“
Wim Wenders: Ein Beckett-Stück, ja.
Peter Pabst: Es war ein Beckett-Stück ... das war die Geburt der Mauer von Palermo Palermo.
Wim Wenders: Das lässt du dir nicht gefallen, dass man dir was abschlägt?
Peter Pabst: Nein, lass ich mir nicht gefallen. Für die Mauer hab ich dann erst mal nach Material gesucht, nach Steinen, mit denen ich wirklich eine Mauer in einer vertretbaren Zeit aufbauen kann und so sicher zum Stehen kriege, dass man verantworten kann, wenn jemand anderes auf der Bühne in der Nähe ist. Dass man die Mauer nicht mit Backsteinen würde aufbauen können, war mir schon klar ...
Wim Wenders: ... waren das diese Hohlblocksteine?
Peter Pabst: Ja, damit hab ich Versuche gemacht. Ich habe ja auf dem Gebiet keinen Sachverstand. Ich weiß nichts von Steinen, von Festigkeit oder von Statik. Ich musste da einfach empirisch rangehen. Das heißt, ich hab mir verschiedene Arten von Steinen gekauft, und immer, wenn wir auf der Bühne Probe hatten, habe ich auf der Hinterbühne eine kleine Mauer aufgebaut, vielleicht drei Meter hoch, so hoch ich konnte mit einer Leiter, und wenn ich fertig war, habe ich den Kopf eingezogen und sie (lacht) mit der Hand umgeschmissen. Dabei hatte ich immer Angst, dass einer nach vorne runter- und mir auf den Kopf fällt. So eine Angst ist auch nützlich, denn da weiß man gleich wieder, dass man sich um dieses Problem kümmern muss. Bei diesen Kleinversuchen hab ich immer geschaut, wie sich die Steine verhalten, wie sie springen, was für einen Ton sie machen beim Aufschlag oder wie viele dabei kaputtgingen. Und so habe ich irgendwann mein Material gefunden.
Wim Wenders: Waren das diese gepressten Kügelchen?
Peter Pabst: Nein, nein, das war nicht Ytong. Die hab ich auch probiert, weil sie sehr schön leicht sind und fest. Aber für meinen Zweck nicht elastisch genug. Ytong ergab zu viel Bruch. Benutzt habe ich dann ein anderes Material. Das sind auch Hohlblocksteine, aber aus gepresster Holzwolle, die mit Zement getränkt wird. Die haben für diesen Zweck etwas ganz Wichtiges, die haben nämlich ein positives und negatives Profil an den Seiten. Sie verschränken sich ineinander. Das heißt, die Mauer steht erst einmal sicher, auch bevor sie auf dem Bau dann mit Zement vergossen wird. Was wir auf der Bühne natürlich nicht mehr gemacht haben.
Wim Wenders: Die sind ein bisschen leichter?
Peter Pabst: Nein, leider ein bisschen schwerer als die anderen. Die Hersteller haben mir immer eine Sonderproduktion gemacht mit mehr Zementanteil für größere Festigkeit.
Wim Wenders: Und wie habt ihr die Mauer dann umgeschubst?
Peter Pabst: Die Mauer durfte ja nicht nach vorne fallen, deshalb stand sie rechts und links eingekeilt in zwei Stabilisierungswinkeln, und schubsen konnte man die nicht mehr. Dazu war die zu schwer und stand auch zu fest. Die wird mit einer Seilwinde nach hinten gezogen. Das machen zwei Techniker auf der Unterbühne. Um den Fall der Mauer kontrollieren zu können, braucht es ein ausgeklügeltes System der Verteilung der Zugkraft auf die Mauer. Und die Techniker unten brauchen Ohropax.
Wim Wenders: Das rumpelt also richtig.
Und hat dann auch ein Statiker nachgeprüft, dass das dann nicht ...
Peter Pabst: Es haben alle nein gesagt, das vergesse ich nie. Als wir die Mauer zum ersten Mal aufgebaut haben, da standen wirklich alle da: die technische Leitung des Theaters, Gewerkschaft, Personalrat, Vertreter des Hochbauamtes und so weiter. Es war unglaublich. Die waren auf der Bühne und sagten alle nein. Das war ein Tag großer Einsamkeit. Ich war da irgendwie alleine und sagte immer nur ja, und die anderen sagten alle nein. Wir haben uns aber zu guter Letzt geeinigt und die Mauer dann fertig aufgebaut, bis zur vollen, ziemlich bedrohlich wirkenden Höhe. Während der Abendprobe hab ich Pina gefragt, ob wir die Mauer jetzt mal umwerfen sollen. Und sie hat gesagt ja.
Wim Wenders: Da hat dir das Herz geklopft, oder?
Peter Pabst: Da war ich schon nah am Herzinfarkt (lacht). Mein lieber Mann, hat mir das Herz geklopft! Das Problem in solchen Situationen ist, dass ich immer nur hoffen kann: „Hab ich genau genug gedacht?“ Erfahrungswerte sind nicht da und helfen kann einem auch keiner.
Das ist aber auch die Befriedigung.
Ich hab oft darüber nachgedacht, warum ich so einen Spaß daran habe, Bedenken zu widerlegen und die technischen Lösungen selbst zu finden. Ich glaube, ich trenne da zwei Aspekte meiner Arbeit als Bühnenbildner. Da ist erst mal der künstlerische Teil, der Entwurf. Der kommt mehr aus dem Bauch. Wenn ich dabei schon über technische Konsequenzen nachdenken würde, dann würde ich gleich einen solchen Schrecken kriegen, dass ich gar nicht mehr den Mut zum Träumen hätte. Zum Entwerfen muss die Fantasie frei sein. Das genieße ich. In dieser Phase habe ich auch Pina immer wieder das Blaue vom Himmel herunter versprochen, ohne zu wissen, wie das nun funktionieren kann. In dieser Haltung waren Pina und ich wieder fast identisch. Sie hat immer frei erfunden, ohne zu wissen, wie das alles zusammengehen soll. Irgendwie haben wir beide uns immer mit dem Rücken an die Wand gestellt. Das ist die Voraussetzung dafür, glaube ich, dass man die Kraft entwickelt, etwas zu verwirklichen, das unmöglich scheint. Und dafür brauche ich meinen Kopf. Der will ja auch etwas tun, und das muss er auch. Ich habe keinerlei Bildung in technischen, mechanischen oder physikalischen Dingen.
Als ich jung war, konnte ich solche Dinge gar nicht denken. Ich habe nicht mal das Abitur geschafft, bin aus der Schule geflogen, weil ich zu blöd war in allen naturwissenschaftlichen Fächern. Mathematik war nicht, Physik war nicht und Chemie war auch nicht.
Das hat sich viel später eingestellt. Heute bereitet mir dieses logische Denken große Freude. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so viel wissen muss. Ich muss nur genau beobachten und logisch denken. Dann kannst du ein Problem auch genau analysieren. Und wenn du verstehst, was der Kern eines Problems ist, dann kriegst du auch raus, wie du es lösen kannst.
Wim Wenders: Ich kenne das von Filmarbeiten. Da kommt es auch oft darauf an, dass man versteht, warum was nicht geht.
Peter Pabst: Damit man es dann trotzdem machen kann.
Wim Wenders: Und im Theater ist das auch so?
Peter Pabst: Da ist es genauso.
Wim Wenders: In Palermo Palermo kommt – ganz selten bei Pina – sogar ein Vorhang vor, glaub ich ...
Peter Pabst: ... das ist der einzige und nur wegen der Mauer.
Wim Wenders: Warum wolltet ihr den Vorhang davor?
Peter Pabst: Weil wir eine Mauer hinter einem Vorhang haben wollten (lacht). Damit man die erst mal nicht sah. So war das ja mal in der Lichtburg geboren worden.
Wim Wenders: Ach so.
Peter Pabst: Also, wir haben uns den Luxus geleistet, das Pathos des aufgehenden Vorhangs. Das ist ja immer auf gewisse Weise ein feierlicher Moment im Theater – der Vorhang geht auf! Das heißt ja, eine Welt wird enthüllt, eine Geschichte beginnt, aber bei Palermo Palermo ging der Vorhang auf und es begann überhaupt nichts. Die Bühne war zugemauert!
Wim Wenders: Das Pathos hat euer Vorhang trotzdem.
Peter Pabst: Ja.
Wim Wenders: Und der Hund? Da gibt es doch auch einen Hund. Was war denn das für einer?
Peter Pabst: Na ja, ursprünglich war das der Hund von Jean, Jean Sasportes, der hatte einen Hund, der hieß Truia. Jean hatte ein Motorrad, eine 750er Honda, und kam aus Marokko. Und das Motorrad hatte vorne auf dem Tank ein Kissen, eine zusammengelegte Decke, aufgeschnallt und ...
Wim Wenders: ... da fuhr der Hund.
Peter Pabst: Genau, Jean setzte sich auf sein Motorrad, ein Pfiff, Truia machte einen Satz und saß auf seiner Decke. Und so fuhren die auch bis nach Marokko. Dieser Hund war unglaublich! Der war vollkommen verrückt und spielte am Anfang diese Rolle in Palermo Palermo.
Wim Wenders: Der hat auch richtig Anweisungen angenommen?
Peter Pabst: Der hat Regieanweisungen angenommen, der fraß gerne und liebte seinen Jean!
Wim Wenders: Mit dem nächsten Stück bist du zu den Feldern zurückgekehrt, aber diesmal hast du ein Schneefeld gemacht. Was ist das für ein Feld?
Peter Pabst: Das war so ein lange gehegter Traum. Jetzt kommen wir ja doch zu den Böden zurück, es ist ja doch eine Geschichte von Böden eigentlich.
Wim Wenders: Wir haben eine Weile lang den Boden der Tatsachen verlassen, jetzt sind wir wieder drauf.
Peter Pabst: Das gehörte zu den Bildern, die mir schon seit Jahren in meinem Kopf herumgegangen sind. Ich wollte schon lange eine Winterlandschaft machen, habe auch immer wieder daran rumgebastelt, aber irgendwie ist es nie was geworden – vielleicht auch, weil ich nicht wusste, woraus ich das machen sollte.
Und dann irgendwann habe ich gedacht: Salz! Ich habe mir Salz im Supermarkt gekauft, habe es in meinen Modellkasten schneien lassen, und es war gut.
Mir war schon klar, dass ich kein Kochsalz nehmen kann. Kochsalz ist aggressiv. Da rostet sofort die gesamte Bühnenmaschinerie und dann krieg ich wirklich Hausverbot. Aber das größere Problem waren die Tänzer. Die tanzen bei uns sehr oft mit nackten Füßen und die Füße sind ja immer geschunden und Kochsalz in den Wunden: das ist gemein.
Ich habe dann in der Apotheke ein neutrales Salz gefunden, das nicht ätzt. Bittersalz. Das kauft man so hundertgrammweise zur Verdauung ...
Wim Wenders: ... ist das so was Ähnliches wie Glaubersalz? Das nimmt man auch, um den Darm zu reinigen. Das kann man also gut vertragen.
Peter Pabst: Ähnlich.
Wim Wenders: Also das ist Bittersalz. Ist das apothekenpflichtig?
Peter Pabst: Nein, ich glaube nicht. Es ist nur sehr teuer. Ich habe es erst einmal gegessen, um zu sehen, wie sich das auf den Magen auswirkt, ob man dann sofort Durchfall kriegt. Weil sich die Tänzer ja darin auch wälzen und es möglicherweise schlucken würden und dann haben sie alle ein Problem. Es passierte aber nichts.
Und dann musste ich eigentlich nur noch den Weg zurückverfolgen von der Apotheke zur Saline, damit ich das bezahlen konnte. Es waren ungefähr zehn Tonnen, die ich da kalkuliert hatte, um sie den Tänzern unter die Füße zu schütten.
Und damit war erst mal die Schneelandschaft da. Das war schön, weil das Salz auch so geglitzert hat wie frischer Schnee in der Sonne. Und frischer Schnee knirscht unter den Füßen und das tat das Salz auch. Das war alles richtig gut.
Wim Wenders: Und das fiel direkt auf den Tanzboden?
Peter Pabst: Das wurde auf dem Tanzboden verteilt, ja.
Die Winterlandschaft war also da. Aber es gab da noch so viele andere Bilder, die Pina auch sehr mochte. Ich hatte schon mal nachgedacht über die Salzkristalle und darüber, dass viele Projektionsflächen eine kristalline Oberfläche haben. Aber Pina und Projektionen, das ging damals für mich noch nicht zusammen.
Doch einmal sagte sie ganz traurig: „Schade, dass wir nicht mehrere Bilder haben können. Aber man kann das ja nicht umbauen zwischen den Bildern.“ Und in diesem Moment habe ich (lacht), mit Entschuldigungen sozusagen vorbauend, sie dann ganz vorsichtig gefragt, ob sie sich vielleicht vorstellen könnte, dass wir die Bilder projizieren.
Und Pina konnte sich das vorstellen.
Das war für mich der eigentliche Anfang der Projektionen im Tanztheater. Der Winter wurde farbenfroh und manchmal richtig märchenhaft und auch absurd. Salz wurde zu Sand, Schnee wurde zur Wüste und manchmal blühten auch Blumen darin. Und dann war wieder Winter. Tänzerinnen liefen in bunten Sommerkleidern in tropischem Wald herum und ein paar Meter weiter fror Dominique Mercy zwischen verschneiten Birken.
Wim Wenders: Da haben die ja praktisch auf einer Leinwand gespielt.
Peter Pabst: Du hast total recht. Ich habe das zwar nie gedacht, aber genau so war es.
Wim Wenders: Das war also der Beginn eurer großen Projektionsphase.
Danach bist du erst mal von der Schneelandschaft in eine Mondlandschaft, nur dass da kein Raumschiff gestrandet ist, sondern ein Schiff.
Peter Pabst: War das vorher?
Wim Wenders: Das Stück mit dem Schiff, das war gleich danach, glaube ich.
Peter Pabst: Das Stück mit dem Schiff – ich erinnere mich gar nicht mehr, was wir uns da alles gedacht haben. Aber unter anderem hatte ich einen Artikel über den Aralsee gelesen. Bei dem sind durch Umweltveränderungen die Ufer bis zu sechzig Kilometer zurückgegangen. Die Schiffe sind aber alle liegen geblieben, wo sie waren. Auf dem Rückflug von Asien habe ich das auch einmal von oben sehen können. Das sah total verrückt aus und sehr traurig ... auch das, was ich dann als Bühnenbild gemacht habe.
Wim Wenders: Ein großes Scheitern ...?
Peter Pabst: Das hat was von Scheitern und von Qual. Ein Schiff will ja auf dem Wasser fahren.
Bei mir war das Schiff in einer Schräglage wie auf einem stürmischen Meer, wenn gerade eine riesige Welle unter dem Schiff hindurchläuft. Aber diese Welle war aus Sand und das Schiff war starr und still. Ich mochte das Modell sehr. Aber ich hab auch große Zweifel gehabt, weil dieses von allen meinen Bildern das Epischste war, das am meisten Erzählende. Und ich war gar nicht sicher, ob das gut war oder was da für ein Risiko drinsteckte. Pina hatte eine andere Angst. Die hatte – das hat sie mir später irgendwann gesagt – Angst, dass das zu sehr wie Der fliegende Holländer aussehen würde.
Wim Wenders: Oder Fellinis E la nave va?
Peter Pabst: Das hätte sie, glaube ich, nicht gestört. Sie hat wirklich Angst gehabt, dass es so aussehen könnte wie in der Oper. Nun bin ich doch ein totaler Bootsnarr und segele so gerne. Deswegen hab ich ihr nur gesagt: „Pina, ich kann dir nicht sagen, ob dieses Bild für dein Stück richtig sein wird. Ich kann dir nur eines versprechen: Wenn ich dir ein Schiff baue, dann sieht das nicht aus wie Der fliegende Holländer.“
Wim Wenders: Das war ja auch ein Dreimaster.
Peter Pabst: Klar, das auch. Ich habe mir dann alle Mühe gegeben, dass der Fischtrawler so realistisch wird, wie es nur geht.
Wim Wenders: Ist das ein halbes Schiff oder geht das?
Peter Pabst: Nach der Premiere hab ich zwei Kaufangebote gekriegt von zwei Ärzten. Die wollten es kaufen, wenn es abgespielt war. Ich hab heimlich gelacht, weil ich gedacht habe: Jungs, wenn ihr wüsstet, wie das unter Deck aussieht!
Wim Wenders: Also ein bisschen traurig war das Schiff schon und das hat dann gleich zu einem richtigen Trauerspiel geführt (lacht). Da liegt dann aber wirklich was Trauriges auf der Bühne. Ein karger Rest eines Gemäuers oder was ist das?
Peter Pabst: Nein, das ist eine Insel in Trauerspiel.
Wim Wenders: Liegt da nicht so ein Grundriss von einem komischen Gemäuer im Boden?
Peter Pabst: Nein, das ist die Form der Insel.
Wim Wenders: Ich kann mich aber erinnern, dass das aussieht, als ob man etwas ausgräbt und dann sieht man die Umrisse von einem Fundament.
Peter Pabst: Ein bisschen konnte man das so sehen, weil es war sozusagen das äußere Ufer und dann die Inselform ...
Wim Wenders: Das ist die Insel, von der wir am Anfang geredet haben, die sich bewegt hat?
Peter Pabst: Ja, ich hatte gedacht, vielleicht ist das schön, wenn ich den Tänzern einen Boden baue, der sich bewegt, eine Insel, die im Wasser schwimmt.
Wim Wenders: Und wie hast du das gemacht, dass die sich bewegt? Das waren doch immerhin über hundert Quadratmeter.
Peter Pabst: Gute hundert Quadratmeter. Ich wollte einfach ein Becken bauen, das Becken mit Wasser füllen und die Insel darauf schwimmen lassen. Das Pikante an dem Projekt war, dass ich nicht wusste, dass kurz vorher der Intendant im Schauspielhaus für eine Inszenierung auch Wasser benutzt hatte und sich darüber so mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr verkracht hatte, dass die erklärt haben: „Auf dieser Bühne kein Tropfen Wasser mehr!“
Und nach diesem Spruch kam ich an und hatte mir ausgerechnet, ich brauche 23 000 Liter! (Lacht.) Damit das Ding schwimmt. Da prallte erst mal was frontal aufeinander.
Als mir der Konflikt klar wurde, war mein erster Gedanke: „Die Feuerwehr muss mein Bühnenbild adoptieren!“ Ich hab also ein genaues Modell gebaut von dem, was ich mir vorstellte, habe es beleuchtet und fotografiert und mich mit dem Sicherheitschef von der Feuerwehr verabredet. Ob ich ihn treffen könnte. Ich habe meine Modellfotos vor ihm ausgebreitet und gesagt: „Das würde ich gerne machen. Ich weiß nur nicht, wie es geht, ich hab lang drüber nachgedacht, und es ist mir eigentlich nur ein Mensch eingefallen, der das wissen kann, und das sind Sie. Ich bin in Ihrer Hand, bitte helfen Sie mir!“
Wim Wenders: Wusste er, wie’s geht?
Peter Pabst: Na klar! Wir wussten es beide, aber wir mussten erst mal in einem Boot sitzen.
Wim Wenders: Hat er deine Idee adoptiert?
Peter Pabst: Er hat sich gefreut, dass ich zu ihm gekommen war, ist sofort mit mir losgegangen und hat mir gezeigt, was sie alles an Material haben und was sie machen können mit Wasser, hat mit mir diskutiert, wie das nun verwirklicht werden und was für Ausrüstung er mir dafür leihen kann.
Wim Wenders: Und was war denn der Trick mit der Insel?
Peter Pabst: Die Insel habe ich mir dann schon selber ausgedacht. Aber der Feuerwehrchef hat mir viele Ratschläge gegeben und wurde dann noch einmal ganz wichtig, weil das Ordnungsamt ja noch nicht im Boot war. Eine von deren Auflagen war, dass wir im Notfall das Wasser innerhalb von zehn Minuten aus dem Haus schaffen müssten. Nun sind 23 000 Liter Wasser nicht so wenig und das muss ja irgendwohin.
Wim Wenders: In die Wupper!
Peter Pabst: Genau! Ich bin wieder zu ihm hin und habe gefragt, womit die Feuerwehr die Keller leer pumpt, wenn zum Beispiel in Köln der Rhein überläuft. Und er hat mir eine Pumpe gegeben, die fünftausend Liter Wasser in einer Minute wegpumpt. Damit hat er mich aus dem Schlamassel gezogen. Und so ging das weiter. Das wurde fast zu einer Freundschaft, so sehr hat die Feuerwehr sich für dieses Bühnenbild engagiert und es dann eben auch dem Ordnungsamt gegenüber verteidigt. Weil das war ja irgendwie ihr Bühnenbild geworden. Wenn das Ordnungsamt noch Bedenken hatte, hat sich die Feuerwehr eingesetzt, sie auszuräumen. Das war ein Glück.
Die Insel selber rauszukriegen, also wie man sie machen muss, war auch wieder empirisch. (Lacht.) Im Januar!
Wim Wenders: War das eine Art Floß ?
Peter Pabst: Ja schon, aber ich wusste nichts Genaues über die Tragfähigkeit der Insel oder deren Verhalten im Wasser und so. Meine Überlegungen dazu waren eher rudimentär. Ich hab mir also erst mal ein kleines Wasserbecken improvisiert im Hof vom Opernhaus, hab mir eine Styroporplatte besorgt, zwei mal einen Meter, zehn Zentimeter dick, habe sie in das Wasser gelegt und bin mal daraufgestiegen – und schon in einer Sekunde hat sich herausgestellt, dass es sehr vernünftig von mir gewesen war, für diese Versuchsanordnung die Warmwasserleitung zu benutzen. Die Platte unter mir haute ab wie ein Surfbrett und ich lag im Wasser – bei einer Lufttemperatur von fünf Grad unter Null. Ich hab aus dem Wasser geguckt und mir war klar: da müssen Bremsen drunter!
Ich hab dann die Insel konstruiert mit einem System von Latten auf der Unterseite, die das Wasser verwirbelten und so die Bewegungen bremsten und weich machten.
Wim Wenders: Hast du irgendwelche Luftkörper da druntergebaut?
Peter Pabst: Nein, der Kern ist aus Styropor, dessen Schwimmfähigkeit reichte schon aus, um das Ganze zu tragen. Die Form der Oberflächen ist dann aus Polyester und Glasfasermatten laminiert. Und ganz obendrauf liegt säckeweise die gemahlene Hochofenschlacke.
Als wir dann fünf Tage vor der Premiere die Insel im Becken montiert hatten und das Wasser einließen, war die Bühne wieder voller Mitarbeiter. So gespannt und aufgeregt waren alle, dass sie Wetten abgeschlossen haben, ob die Insel schwimmen würde oder nicht.
Ich hatte mir ausgerechnet, dass ich ungefähr fünfzehn oder sechzehn Zentimeter Wassertiefe brauchte, dann müsste das Ding aufschwimmen. Mit zwanzig Tänzern drauf. Und wirklich, bei sechzehneinhalb Zentimetern fing die Insel an, sich zu bewegen! Das war toll, wirklich einer dieser großen Glücksmomente.
Wim Wenders: Die war nicht nach unten vertäut?
Peter Pabst: Nein, die Insel schwimmt völlig frei. Die Bewegungen waren nur durch die Formen der beiden Ufer eingeschränkt. Ich kannte ja das Stück und Pinas Choreografien noch nicht und wusste deshalb auch nicht, wie und wo die Tänzer die Insel betreten oder verlassen würden. Diese etwas komplizierten Uferformen waren so gemacht, dass sich die Insel zwar frei bewegen, aber nie unbegrenzt drehen konnte. Und ich wollte sicherstellen, dass unter keinen Umständen irgendwo ein Abstand von mehr als einem Meter zwischen Insel und Ufer entsteht. Die verhakten sich immer vorher und stießen die Insel wieder in eine andere Richtung.
Wim Wenders: Aber die Abstände haben dann geschwankt, die waren mal größer und mal kleiner?
Peter Pabst: Na klar, das war eine ständige Veränderung.
Die Hilfe der Feuerwehr hatte übrigens noch einen wunderbaren Nebeneffekt. Ich hatte schon seit Jahren von einem Wasserfall geträumt. Ich wusste nur nicht, wie ich den machen sollte. Ein Wasserfall braucht einfach viel Wasser, und wenn ich versucht hätte, sagen wir mal zehntausend Liter Wasser auf die Bühnengalerie zu packen, wäre die gleich mit heruntergekommen.
Aber mit diesen gigantischen Feuerwehrpumpen war das plötzlich möglich, genügend Wasser da hochzutransportieren ...
Wim Wenders: ... dann war oben nicht das ganze Gewicht ...
Peter Pabst: ... genau! ... und wieder herunterfallen zu lassen. Endlos.
Mein großes stabiles Becken hatte ich an dieser Stelle dann tiefer gebaut, sodass es mit seiner riesigen Wassermenge in der Lage war, den Druck des herabfallenden Wassers aufzufangen.
Also hatten wir endlich einen Wasserfall.
Wim Wenders: Tja, so kommt eins zum anderen ...
Peter Pabst: Du sagst es, als das nämlich alles gelöst war, bin ich übermütig geworden. Da fand ich, es wäre eigentlich verrückt, wenn das Wasser anfangen würde zu brennen ...
Wim Wenders: Jetzt wird es aber richtig spannend!
Peter Pabst: Das erzähle ich aber nicht mehr, sonst nimmt das hier gar kein Ende mehr. Aber gebrannt hat es schon.
Wim Wenders: Danach wurde es so karg, dass man denken musste, karger geht’s nicht mehr.
Peter Pabst: Ja, Danzón, das war eine leere Bühne ...
Wim Wenders: ... zuerst mal. Aber dann erschien plötzlich, über den ganzen Bühnenraum, doch eine Projektion. Da wurde es das Gegenteil von karg. War das die größte Bildprojektion bis dahin?
Peter Pabst: Bis dahin ja, die Videoprojektion war was Neues. Vorher, in dem Madrid-Stück, waren das Dias gewesen.
Wim Wenders: Anfangs ging das nur mit Dias?
Peter Pabst: Erst mal nur mit Dias, weil ich ja gleichzeitig für die Tänzer viel Licht gebraucht habe. Und die Videobeamer waren noch nicht lichtstark genug dafür. In „Danzón“ sind ja auch viele Dias drin.
Aber zunächst einmal fing die Arbeit für Danzón mit einer Klemme an. Ich war die ganze Zeit beschäftigt mit zwei Theaterproduktionen in Berlin und in Hamburg, die sich verschoben hatten, und kam erst etwa einen Monat vor der Premiere nach Wuppertal. Und hatte auch Lust darauf, mal etwas ganz Leichtes zu probieren, etwas Flüchtiges, das immer wieder zur leeren Bühne zurückkehrt.
Ich habe mich neben den unkonventionellen, den „lokalen“ Materialien, über wir schon geredet haben, immer sehr für die ganz klassischen Materialien und Techniken der Bühnenbildnerei interessiert.
Die Opéra de Paris hat mal eine Ballettaufführung aus dem 19. Jahrhundert rekonstruiert. Die habe ich gesehen und ich fand es umwerfend, was für Wirkungen, auch räumliche Wirkungen, die damals nur mit bemalten und beklebten Tülls erzeugt haben.
Ich habe mir also ein System von Theatertüllen gemacht, die in Farbe und Dichte genau abgestimmt und in die Tiefe gestaffelt gehängt waren. Hinten in der Bühne hing als Abschluss eine Projektionsfolie. Wenn man in dieses System hineinprojizierte, ergab das ganz große Raumbilder, fast wie Hologramme. Nur von den teuersten Plätzen genau in der Mitte sah man das nicht.
Die Tänzer konnten davor oder dazwischen tanzen und wurden Teil dieser Bilder, die ihrerseits die Welt der Tänzer wurden. Und diese Bildräume veränderten sich auch ständig, indem Schichten dazukamen oder verschwanden. Das war ganz beweglich und flexibel und manchmal blieben auch die projizierten Bilder einfach im großen leeren Bühnenraum übrig. Damals habe ich auch angefangen, mich für die Zartheit von Projektionen in schwarzen Räumen zu interessieren.
Eigentlich war alles gut. Wir hatten endlich mal ein leichtes und schnell aufzubauendes Bühnenbild, hatten am Ende aber dessen Flexibilität so weit ausgeschöpft, dass die komplizierten Abläufe die ganze gesparte Aufbauzeit für die Proben aufbrauchten.
Und dann sagte Pina mir irgendwann leise, sie überlege, nach so vielen Jahren in diesem Stück wieder selbst zu tanzen!
Ich erinnere mich noch genau an meine erste Reaktion auf diese Nachricht: So eine Gemeinheit! Ich hab eh schon so wenig Zeit und jetzt geht sie auf die Bühne und die ganze Welt, alle werden sie aufgeregt kommen und schauen.
Pina überlegte, ob sie sich zu ihrem Tanz vielleicht Bilder mit Fischen wünschen sollte. Und ich dachte: Na gut, dann hole ich mir einen schönen Unterwasserfilm aus der Stadtbildstelle oder einer Filmbibliothek. Nur, da gab es gar nichts Brauchbares. Diese Filme waren alle auf Lernen und Didaktik aufgebaut und keiner nahm sich Zeit, sodass die Bilder sich hätten ausbreiten können.
Allmählich dämmerte mir, dass ich wohl selbst einen Film für Pina würde machen müssen.
Ich bin dann losgezogen mit meiner kleinen Videokamera, in die Zoos und in die Aquarien, und hab mich umgesehen und gefilmt. Und bin mit dem Ergebnis zu Pina in die Lichtburg gegangen. Nun konnte Pina sehr verletzend sein, wenn sie selber Qualen litt. Nicht, weil sie verletzend sein wollte, sondern weil sie ihre eigene Qual zeigte. Sie hat dann immer „öööhhh“ gemacht und dazu so ein schreckliches Gesicht und genau so lief das in dem Moment auch.
Wim Wenders: (Lacht.)
Peter Pabst: Ich weiß das noch so gut wie heute. Ich bin da reingekommen mit meinem Filmchen und sie macht schon so ein Gesicht, bevor ich nur Guten Tag sagen konnte. Das brauch ich jetzt nicht, hab ich gedacht, habe die Kassette vor sie auf den Tisch gelegt, habe mich umgedreht, bin in mein Auto gestiegen und wieder nach Hause nach Köln gefahren. Und kaum kam ich zu Hause an, da war sie am Telefon: Sie hätte sich den Film angeguckt, das seien ja unglaubliche Bilder. Sie sei total aufgeregt und ob ich nicht zurückkommen könnte. Bin ich wieder zurückgefahren. So wurden wir uns schon mal einig über die Art der Bilder.
Bei einem Freund aus einem Medieninstitut in der Zeche Zollverein in Essen erlebte ich erste Versuche mit einem ganz neuen Videobeamer von Barco. Und was ich da sah an Lichtstärke, an Strahlkraft der Farben und an Schärfe konnte ich mir bis dahin nicht vorstellen, auch wenn das heute alles von vorgestern ist. Damit war klar, wir können das auf Video drehen, und das war dann einfacher.
Wim Wenders: Und viel praktischer, bei jeder Vorführung dann ...
Peter Pabst: Ja, ja. Und die hatten auch eine der ersten digitalen Kameras bekommen, ich glaube, Digibeta hießen die, und schickten mir eine Kamerafrau, die die Bilder damit filmte, die ich brauchte. Unter anderem diesen kleinen roten Fisch, der da immer auf und ab saust, der Pina dann durch den Raum wirbelt und fliegen lässt, während sie doch mit beiden Beinen auf der Erde steht.
Wim Wenders: Wir sind also jetzt im digitalen Zeitalter angekommen.
Peter Pabst: Das sind wir.
Pina hat dann immer für sich nachts geprobt, nach den eigentlichen Proben, wenn niemand mehr da war, und ich habe in dieser Zeit hinten im Zuschauerraum den Film geschnitten.
Es blieb aber trotzdem noch aufregend! Pina wäre nicht Pina gewesen, wenn sie nicht die Frage, ob sie denn in dem Stück auftritt oder nicht, bis nach dem Beginn der Premiere offengelassen hätte (lacht). Wir haben die Premiere sozusagen mit einem Zweiwegeplan begonnen: wenn Pina in einem bestimmten Moment auf die Bühne geht, zeigen wir den Film, wenn nicht, geht es anders weiter. Sie ist dann aber aufgetreten und hat getanzt.
Wim Wenders: Und ab dann immer?
Peter Pabst: Dann immer.
Wim Wenders: Einmal ohne Fisch, habe ich im Archiv gesehen.
Peter Pabst: Einmal ohne Fisch, weil da der Beamer nicht funktioniert hat. Ich war in dieser Vorstellung nicht dabei.
Wim Wenders: Von dem roten Fisch bist du auf eine rote Pyramide gekommen, die dann genüsslich zerpflückt wird. Aus was war die Pyramide in Fensterputzer?
Peter Pabst: Hongkong ist auch einer dieser Orte, die einen Besucher mit Eindrücken fast erschlagen, einen überschütten mit Bildern von Menschen, Landschaft, Werbung, Architektur, subtropischer Natur ohne Ende. Und da lässt man sich natürlich gerne verführen.
Ich hab also mit sehr bildreichen, farbenprächtigen Versuchen für die Bühne angefangen. Aber das hat sich sehr schnell verändert. Ich wurde schnell vorsichtiger und bin schließlich bei einer reinen Abstraktion angekommen. In einer ganz klassisch schwarz ausgehängten Bühne steht ein Berg aus leuchtend roten Blüten, acht oder neun Meter im Durchmesser und etwa viereinhalb Meter hoch. Und eigentlich eher absurd.
Wim Wenders: Und was war unter dem Blütenberg?
Peter Pabst: Das sage ich gleich. Ich hab das erst einmal Pina gezeigt. Der gefiel das auch, aber sie fragte sofort: „Muss der immer da stehen?“ (Lacht.) Ich hab natürlich sofort leichtsinnig gesagt: „Nein, wir können ihn auch bewegen.“ Da war der Schwierigkeitsgrad schon mal wieder um drei Nummern gestiegen.
Mir war von vornherein klar, dass dieser Blumenberg ein wunderbares Spielzeug werden muss für die Tänzer. Dass ich ihn also so schön, so weich, so komfortabel und angenehm bauen muss, dass sie nur noch auf diesem Blumenberg herumtosen wollen wie die Kinder.
Ich habe also eine Stahlkonstruktion auf speziellen Rollen entworfen, die ganz gleichmäßig in alle Richtungen bewegt werden kann, und habe sie mit Holz eingedeckt, dass es ein Hügel wurde. Und diese Holzteile habe ich dann ringförmig in vielen Lagen ganz dick und weich polstern lassen. Der sah im Rohbau aus wie das Michelinmännchen.
Wim Wenders: In Ringen?
Peter Pabst: Ja, in Form von Ringen immer um den Berg herum, um zu verhindern, dass die Blumen, die daraufkamen, gleich herunterrutschen würden. Aber wirklich ganz dick und weich wie ein tolles gewaltiges Kissen. Dieses Kissen wurde rot bemalt und mit Blumen dicht beklebt, für noch besseren Halt und um schon mal eine „blumige“ Unterschicht zu haben. Und dann habe ich immer mehr rote Blüten daraufgeschüttet. Am Ende waren es, glaube ich, 800 000 Blüten.
Wim Wenders: Was für Blüten waren das?
Peter Pabst: Das waren Rosen und Bauhinia, die Wappenblüte von Hongkong. Die habe ich mir aber erst machen lassen müssen, weil es die nicht gab.
Wim Wenders: Bei demselben in Hamburg?
Peter Pabst: Über denselben in Hamburg, ja.
Wim Wenders: Die Projektionen in dem Stück waren schon richtig sophisticated, das hat mich sehr beeindruckt, was du da projiziert hast.
Peter Pabst: Was war denn da alles?
Wim Wenders: Alle möglichen Bilder aus Hongkong, wenn ich mich recht erinnere.
Peter Pabst: Ja, da kamen viele der Bilder vom Anfang wieder zurück. Die hatten jetzt ihre Welt auf der Bühne gefunden. Das war auch eine schöne und unerwartete Entdeckung, wie dieser rote Blumenberg, von dem ich dachte, der kann nun wirklich nichts anderes, außer eben ein roter Blumenberg zu sein, wie der diese Bilder aufnahm, seine Struktur veränderte und mit den Bildern lebte.
Wim Wenders: Und aus dem Schiff wurde ein Auto? Ein Mercedes. Den hast du in Leichtbauweise hergestellt, oder?
Peter Pabst: Na ja, das war schon ein direktes Zitat aus der chinesischen Bestattungstradition. Die geben ihren Toten eigentlich alles mit, was diese auf der anderen Seite brauchen könnten. Essen, Kleider, Geld und vieles mehr, was ihnen einfällt.
Wim Wenders: In Palermo übrigens auch, nur umgekehrt, da bringen die Toten die Geschenke, am Totentag.
Peter Pabst: Das alles muss verbrannt werden und deshalb wird es aus Papier gemacht.
Wim Wenders: Brennt auch besser ...
Peter Pabst: ... und außerdem glauben viele, dass die Toten einmal im Jahr auf die Erde zurückkommen, und wenn ihnen dann etwas fehlt, könnten sie diesen Tag ja nutzen, um es sich zu holen. Und deshalb denkt man da besser wirklich an alles. Zum Beispiel auch an Transport.
Ich habe ein Foto aus den späten Zwanzigerjahren gefunden von einem Ford-T-Modell, das sie seinem Besitzer, einem Fabrikdirektor, mitgegeben haben. Mit Chauffeur! Alles aus Papier!
So habe ich also für ein paar Hundert Mark eine alte Mercedes-S-Klasse gekauft und für das gelbe Papierauto als Form benutzt. Das hat uns viel Werkstattzeit gespart.
Ich glaube, das Papierauto wirkt nur deshalb so stark, weil die Dimension und die Proportionen so real sind.
Es wird immer über diesen echten Mercedes kaschiert. Leuchtend gelb und wenn es kaputt ist, wird ein neues gemacht. Den alten Mercedes heben wir dafür auf.
Wim Wenders: Ah ja, den kannst du dann jederzeit neu als Schablone benutzen.
Peter Pabst: Ja.
Wim Wenders: Und dann passiert in dem Stück noch viel in der Luft, Hängebrücken, Trapeze und so weiter. Das ist schon wesentlich komplexer als viele der Sachen davor und danach.
Peter Pabst: Das ist ein sehr verspieltes Bühnenbild, das sich überall breitmacht, das stimmt. Da haben sich diese vielen Fantasien wieder zurück ins Spiel gedrängt. Da gibt es auch noch einen Drachen. Ich habe in einer der luxuriösesten Wohngegenden von Hongkong einen riesigen Wohnblock gesehen, der stand wie ein Damm an einem Berghang. Die Wohnungen darin waren unbezahlbar teuer. Nun weiß man in China, dass ein Drache auf dem Berg wohnt und dass er ab und zu herunter zum Meer kommen muss, um zu trinken. Da war dieser Wohnblock ein Hindernis. Also hat der Bauherr ein Loch gelassen in diesem Bau, etwa fünf Wohnungen breit und sechs Stockwerke hoch, in Geldwert kaum zu bemessen, nur damit der Drache einen Durchgang hat, wenn er am Meer trinken möchte.
Also einen Drachen wollte ich bei uns auch haben. Und dass Drachen so viel Durst haben, weil sie Feuer spucken, weiß man auch.
Dabei sind mir diese Heißluftballons eingefallen. Die fauchen doch immer so, wenn die Feuer machen – genau wie ein Drache ...
Wim Wenders: ... schuhhh ...
Peter Pabst: ... und dann habe ich bei einem Ballonfliegerclub angerufen und gefragt, ob ich mir angucken kann, wie das funktioniert. Schließlich konnte ich denen so einen großen Brenner abkaufen und habe eine Eisenkiste darum herum gebaut, mit einem kleinen Fenster vorne drin. Diese Kiste kommt irgendwann auf die Bühne, ganz unauffällig, aber plötzlich macht die „schuuuhh“ und spuckt Feuer in gewaltigen Stößen. Das war dann mein Drache.
Wim Wenders: Da hatte auch die Feuerwehr nichts dagegen?
Peter Pabst: Nein, das hatten wir genau miteinander abgesprochen, wie das konstruiert wurde und was dabei zu beachten war.
Wim Wenders: Also, nach all diesen gefährlichen Experimenten kam ja dann mit Masurca Fogo wieder sicherer Boden unter eure Füße. Das ist ein großer Kubus voller ... was ist das? Erde?
Peter Pabst: Also in dem Fall weiß ich wenigstens, was ich gemeint habe. Entstanden ist das Bühnenbild, so wie man es jetzt sieht, allerdings eher zufällig. Wir hatten wieder einmal mehrere Möglichkeiten diskutiert. Unter anderem hatte ich eine abfallende rohe Landschaft aus Stein ausprobiert, mit Glaswänden, die darin standen. Aber es gab auch einen schräg verzogenen, sehr geschlossenen weißen Raum.
Pina kam, schaute sich das an und ging sehr bald wieder, ohne sich weiter zu äußern. Sie war wohl nicht so begeistert, weder von dem einen noch von dem anderen.
Es war eigentlich eine Situation, wie wir sie schon oft erlebt hatten, auch, dass die Zeit diesmal echt knapp wurde. Nun macht es in solchen Situationen überhaupt keinen Sinn, etwas erzwingen zu wollen. Ich hab mich also in Geduld geübt und – nur um etwas zu tun – die Landschaft aus Stein in den schrägen weißen Raum eingebaut, als wäre Lava durch die einzige Öffnung oben rechts in diesen klaustrophobischen weißen Raum geflossen.
Pina kam wieder vorbei, schaute sich an, was ich da gemacht hatte, und wirkte irgendwie ungehalten.
„Damit habe ich jetzt nicht gerechnet“, brummte sie unwirsch und ging.
Ich habe dann gewartet, obwohl alle Werkstattfristen längst verstrichen waren, einen Tag, zwei Tage. Nach drei Tagen habe ich schließlich zu ihr gesagt: „Pina, jetzt müssen wir schon etwas entscheiden, sonst haben wir am Ende gar nichts.“
Da schaute sie mich ganz erstaunt an: „Aber ich hab es dir doch schon gesagt!“
Ich: „Was hast du mir denn gesagt?“
„Na, dass ich das gut finde.“
Darauf ich: „Ach so, das habe ich irgendwie nicht gehört (lacht). Muss ich überhört haben.“
Und das war dann das Bühnenbild zu Masurca Fogo.
Wim Wenders: Danach hast du dann wirklich was Wunderschönes gemacht, eine wunderschöne Wiesenlandschaft.
Peter Pabst: Oje, oje.
Wim Wenders: Das war nach der kargen Lava nun das krasse Gegenteil, oder?
Peter Pabst: Oje, ja.
Wim Wenders: Eine traumhafte Landschaft im wahrsten Sinn des Wortes.
Peter Pabst: Ja, Felsen, Moos und Wasser.
Wim Wenders: Moosig ist das?
Peter Pabst: Eigentlich ein riesengroßer Felsen, der komplett mit Moos bewachsen ist und mit Farnen, mit ganz vielen Arten von kleinsten Pflanzen.
Wim Wenders: Moos ist sicher doch das Schwerste.
Peter Pabst: Ja, ist es auch. Und hier kommt auch noch Wasser überall aus dem Felsen und fällt glitzernd in die Tiefe, wie feine Perlenschnüre, die beim Auftreffen leise Geräusche machen. Dabei macht das Wasser ganz unterschiedliche Geräusche, je nachdem, wo das Wasser auftrifft, ob es wieder in die Pflanzen fällt oder unten auf die Steine oder in eine Wasserpfütze. All dieses Plätschern hört man fast nie. Aber manchmal, wenn plötzlich die Musik weg ist, dann sind da mit einem Mal leise feine Wasserklänge in der Luft.
Bei Wiesenland sind übrigens zum ersten Mal Bergsteiger aufgetaucht, ich hab neulich alte Modellfotos gefunden, da hab ich irgendwann mal kleine Bergsteiger in das Modell reingebaut.
Wim Wenders: Die sind dann allerdings erst wirklich ...
Peter Pabst: ... bei Rough Cut auf die Bühne gekommen, ja, das ist wahr. Die sind damals, also bei Wiesenland, nur als Gedanke schon mal bei mir aufgetaucht.
Pina hat sich das Modell für Wiesenland angeguckt und fragte wieder: „Kann das noch etwas anderes?“ Und ich habe spontan geantwortet: „Man kann es umlegen.Wir können diese Wand umlegen, dann wird es eine Landschaft für die Tänzer, dann können die daraufsteigen und tanzen.“
Wim Wenders: Das verändert in der Tat alles. Eine Metamorphose.
Peter Pabst: Ich hab es aber auch noch andersherum gedacht – davon hab ich neulich auch ein Modellfoto gefunden – und habe Pina angeboten, wir könnten den Felsen auch über die Bühne hängen. Eine Decke aus Moos. Dann könnten die Tänzer da alle rausfallen (lacht) und - springen, aus dieser Moosdecke. Oder die können Leitern rausstecken und von oben auftreten. Das hat aber Pina Gott sei Dank nicht so interessiert. Daran hätte ich mir nun wirklich das Genick gebrochen (lacht).
Wim Wenders: Die Wände hätte ich sehen wollen!
Peter Pabst: Aber hoppla, es war auch so schon nicht schlecht. Diese riesige Wand stand wegen des ganzen ausströmenden und tropfenden Wassers in einem Becken. Um sie umlegen zu können, musste sie erst einmal einen halben Meter hochgezogen werden, dann an der Unterkante mit Seilzügen nach vorn bewegt und außerhalb des Beckens ganz langsam abgesetzt werden. Von da an legte sie sich wie von selbst um, schob sich dabei wie ein grünes Monster ganz langsam vorwärts, immer auf die Zuschauer zu. Und natürlich wollte ich das Ganze dann noch ein bisschen komplizierter haben. Ich fand es aufregender, wenn sich die Wand während dieser Bewegung noch ein bisschen aus der Längsachse verdrehen würde! Zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich noch gedacht, all das sei ganz einfach ...
Aber dann hatte Manfred Marczewski, unser technischer Leiter, nachgerechnet: Die Wand war über fünf Tonnen schwer! Der technische Direktor der Wuppertaler Bühnen wollte aber auf gar keinen Fall zulassen, dass wir ein Gewicht von fünfeinhalb Tonnen im Theater aufhängen und hochziehen.
Da ging ein Tanz los, der war wirklich irrsinnig. Die Einsprüche und Bedenken hörten gar nicht mehr auf zu wachsen.
Viel später, als irgendwann alle Einwände ausgeräumt schienen und die Mooswand mitsamt ihrer Metamorphose im Bau war, hab ich wieder mit meiner Assistentin dagesessen und hab gesagt: „Ich habe gedacht, dass es einfach zu bauen und einzurichten ist, und jetzt stellt sich heraus, es ist das Komplizierteste, das Schwerste und das Teuerste, das wir überhaupt je gemacht haben. Ich glaube, jetzt gibt es nur noch eine Lösung – jetzt muss es auch das Schönste werden!“
Irgendwie, denke ich manchmal, ist es das auch geworden.
Wim Wenders: Denke ich auch.
Peter Pabst: Dann hat es alles funktioniert und wir haben es oft gespielt. Wir sind auch viel damit verreist.
Wim Wenders: Die Wand ist sogar gereist?
Peter Pabst: Ja, wir haben es in Ungarn gespielt, haben es nach Tokio gebracht, schon zweimal nach Paris und so fort.
Wim Wenders: Danach hast du dann Wände benutzt, die viel leichter sind. In Água kommen Wände vor, die gar keine sind. Die sehen nur aus wie Wände. Die heben sich anscheinend ganz leicht in die Luft, wie Vorhänge.
Peter Pabst: Nein, das sind schon Wände.
Wim Wenders: Richtige Wände?
Peter Pabst: Ja und die sind nicht einmal leicht. Die wirken nur luftig, glaube ich, wegen ihrer Form, weil sie gebogen und sehr glatt sind. Das ist keine Architektur mehr, sondern abstrakte Form. Und weil sie fast geräuschlos in die Luft schweben und auch geräuschlos wieder auf den Boden zurückkehren.
Diese Wände hatte ich auch schon von vornherein als Projektionsflächen gedacht. Água war ja ein Stück über Brasilien, und dieses Brasilien war beschwingt und voller Musik, bunt und tanzend, eine nicht endende Flut von Bildern und vielfältigen Eindrücken. Ich glaube, da wollte ich mit meinem Bühnenbild „mittanzen“. Das Bühnenbild für Água war schon geboren mit projizierten Bildern, bevor der Raum feststand.
Und wir hatten ja vorher schon Masurca Fogo gemacht. Das hat sicher miteinander zu tun. Wir waren schon heimisch im Umgang mit solchen Bilderfluten.
Vielleicht sollten wir aber doch noch einmal einen Moment zu Masurca Fogo zurückkehren: Da hatten wir ja diesen klaustrophobischen Raum voller Lava, und Pina hatte mich gefragt, ob wir auch eine Leinwand haben könnten. Ihr hatte in Portugal jemand ein Video von den Kapverdischen Inseln gegeben: Musiker auf einer Bananenplantage, ein
Tanzwettbewerb und mehr. Von diesem Band wollte sie gerne einige Bilder in ihrem Stück benutzen. Also musste eine Leinwand her.
Später auf der Bühne, während einer Probe, hat mich Pina nach den Bildern gefragt. Die Leinwand kam herunter und wir projizierten darauf. Musizierende und singende Arbeiter umgeben von dem unglaublichen Grün riesiger Bananenblätter, die von der Sonne durchschienen waren. Ich hatte aber etwas gesehen, als die Leinwand herunterkam, nur für einen kurzen Moment.
„Pina, kann ich mal die Leinwand wegnehmen?“
Und schon schossen die ganze Farben, die Männer, ihre Bewegungen und ihr Rhythmus in den Raum hinein auf Boden, Wände und Decke. Der ganze Raum geriet in Bewegung, nichts war mehr klaustrophobisch, alles war frei und weit und offen.
Und dann fing das Spiel der Bilder wirklich an. Mit stürmischem Meer, mit gigantischen Wellen, die gegen den Lavafelsen krachten und alles mit ihrer Gischt füllten, und diesen Blumen, die dann am Schluss aufblühten und die ganze Bühne in ihre Farben tauchten, vollkommen überdimensional. Ein Spiel zwischen klaustrophobischer Enge und unendlicher Weite.
Wim Wenders: Ich erinnere mich an den Raum. Der war echt toll.
Peter Pabst: Das war also schon da gewesen, als wir Água machten. Und es war bald klar, dass Brasilien sich durchsetzen würde.
Wim Wenders: War auch die Sofa-Landschaft brasilianisch angehaucht? Könnte von Oscar Niemeyer sein, der hat ja auch mal Möbel gemacht.
Peter Pabst: Schön, dass du es eine Landschaft nennst. Aber einen stilistischen Gedanken habe ich dabei nicht gehabt. Der Raum selbst mit seiner Kühle könnte was mit Niemeyer zu tun haben. Aber ich hab nur gedacht, ich mache Sofas, irgendwie (lacht). Die Sofa-Landschaft ist eine gelegentliche Form in diesem runden Raum, aber meistens „tanzen“ ja auch die Sofas. Die sind eigentlich immer unterwegs, sehr mobil.
Den Regenwald, der den Raum umgibt, den hab ich von Anfang an gedacht. Eigentlich ist dieser runde weiße Raum auch eine Insel im Regenwald. Nur wenn die Wände hochgehen, wird der sichtbar – wie ein Fries aus Natur. Und plötzlich ist da so eine elegante Garden Party, die Pina da hineinerfunden hat. Das hat alles ganz viel mit Brasilien zu tun.
Wim Wenders: Das ist das Partyvolk schlechthin.
Peter Pabst: Ich mag die Szene sehr. Das war am Ende auch eine der wenigen Szenen nur mit Bühnenlicht, ohne Bilder und Projektion.
Wim Wenders: Wo du Licht erwähnst, bei dem Lichtsetzen hast du auch immer mitgearbeitet, oder?
Peter Pabst: Ja, immer. Schon beim Entwerfen kann ich Räume gar nicht anders denken. Ich bin ja – anders als beim Film – in dieser schwarzen Box drin und muss meine ganze Welt erst schaffen. Und das Licht ist dabei eines der ganz grundsätzlichen Gestaltungsmittel. Das Bühnenbild für Danzón besteht eigentlich fast nur aus Licht. Wenn ich Bühne oder einen Raum denke, dann denke ich auch Licht.
Ich hab eine ziemlich gute Beleuchtungsanlage für meinen Modellkasten. Damit kann ich schon sehr viel ausprobieren, was das Bühnenbild so braucht und was für Möglichkeiten und Wirkungen darin stecken.
Wir haben nie einen Lichtdesigner gehabt, schon aus dem Grund, dass nie Zeit für so jemanden da war. Das haben wir immer zusammen mit unseren Beleuchtungschefs gemacht. Jetzt ist das Fernando Jacon, du kennst ihn ja. Er war auch schon lange bei den Bühnenproben dabei, hat also schon vieles beobachtet, was die Tänzer machen.
Eigentlich war das Bühnenbild in den Grundzügen immer schon vorher im Modellkasten beleuchtet. Natürlich hat sich das geändert, wenn das Stück fertig war, dann ging es um die Tänzer, die Atmosphären einzelner Tänze und Szenen. Wir haben ein neues Stück ganz oft in nächtlichen Sessions beleuchtet, zwischen den Proben. Ganz kurz vor der Premiere. Und das konnte sich auch immer wieder ändern. Und mit den Videos war das ähnlich. Das Meiste habe ich auch schon im Modell gemacht.
Wim Wenders: Jetzt kommen wir noch mal zu einer unmöglichen überdimensionalen Architektur: Für die Kinder von gestern, heute und morgen. Die erscheint ja erst mal unglaublich solide und löst sich dann trotzdem auf. Und dann gibt es einen weißen Tanzboden, also es sieht auf den ersten Blick kompakt und massiv aus, und dann löst sich das trotzdem irgendwie auf. Was war denn da der Ansatzpunkt? Weißt du das noch?
Peter Pabst: Natürlich weiß ich das wieder nicht, wahrscheinlich, weil ich es nie gewusst habe.
Das hat mal ganz realistisch angefangen.
Wim Wenders: Erzähl trotzdem.
Peter Pabst: Das war ein ganz realistischer Raum, Architektur um die Jahrhundertwende. Durch die Fenster gab es einen ganz realistischen Ausblick auf eine Wuppertaler Straße. Großfoto, sehr raffiniert, perspektivisch und proportional ganz genau. Die Wohnung lag im ersten Stock. Ich glaube, da wollte ich mir nur klarmachen, dass ich wieder in Wuppertal bin.
Aber das ging natürlich nicht: „Da musste etwas passieren!“ Ich habe den Raum zerstört. Daraus entstand ein Raum, der zerfallen konnte. Die Wände klappten und fielen auseinander.
Wim Wenders: Eben, und?
Peter Pabst: Das war wieder mal eine komplizierte Technik. Es wirkte auch zu technisch und es war in seinen Möglichkeiten zu begrenzt. Langweilig!
Also habe ich das „beruhigt“, der Raum wurde wieder einfach, weiß und groß. Der sieht eigentlich erst mal aus wie ein normales Bühnenbild. Und dann hat mich nur noch interessiert, wie man daraus mehrere, verschiedene Räume machen kann.
Da ist vielleicht unbewusst ein ganz privater Gedanke wieder aufgetaucht. Nämlich: „Warum habe ich mir nie ein Haus gebaut?“ Und wenn ich es doch noch bauen würde, wie wäre das? Vielleicht einfach wie eine große Schachtel, darin drei oder vier Wände, die man verschieben kann, und dann würde ich es jeden Tag so schieben, wie ich es gerne möchte: kleines Zimmer, große Halle oder verschachtelt.
Und so wurde unser riesiger weißer Raum mobil, ich habe ihn einfach fahren lassen. „Mobil“, das hat wohl auch mit dem Tanztheater zu tun. Mobilität, merke ich gerade, kommt häufiger vor.
Wim Wenders: Er wirkt erst mal solide und massiv. Und dann ...
Peter Pabst: ... na ja, der ist auch sehr solide und schwer. Wir haben ihn sorgfältig gebaut, damit er aussieht wie eine wirkliche Architektur. Sonst wäre es ja langweilig. Man soll sich ja wundern, dass diese Wände fahren, man kann ruhig Angst haben, dass sie umkippen, und verunsichert sein, ob die wirklich unter Kontrolle sind. Das sind ja alles Gefühle, die sich mit einem Raum verbinden und auf alles andere übertragen.
Schon bei dem Entwurf der Wände sprachen alle architektonischen Details dagegen, dass sie bewegt werden konnten. Zu den statischen Problemen kamen Kippmomente und schwere Gegengewichte, gewaltige Biegekräfte, kinetische Probleme und enorme Torsionskräfte, Verwindungen bei plötzlichen Rollwiderständen.
Das sieht ganz simpel aus, ist aber technisch wirklich eines der komplizierten Bilder. Ich habe unseren technischen Leitern, Manfred Marczewski, Jörg Ramershoven, und ihren Mitarbeitern das Leben damit ganz schön schwer gemacht. Aber die Wirkung dieses Raumes liegt gerade darin begründet.
Wim Wenders: Torsionskräfte – kann man sich kaum vorstellen ...
Peter Pabst: Die Wände sind ja alle unten offen. Überall große Türöffnungen. Die sind wirklich empfindlich wie die Prinzessin auf der Erbse. Die müssen allein ein irrsinniges Gegengewicht haben, nur damit die nicht umfallen.
Wim Wenders: Wie die Straßenbahn in San Francisco. Da muss auch auf der anderen Seite das gleiche Gewicht hängen.
Peter Pabst: So ähnlich ist das da auch, ja.
Ich hatte zwar auch für dieses Stück ungefähr zwei Stunden Videos vorbereitet, aber irgendwann war mir klar: da kann kein Bild rein.
Wim Wenders: Danach wurde es aber dann ganz karg, mit Nefés?
Peter Pabst: Da fängt jetzt etwas an, was ich manchmal mit mir selber spöttelnd meine „Zen-Stücke“ nenne (lacht). Weil die so einfach sind, die Reduktion schlechthin.
Wim Wenders: Bis hin zum letzten, dem Chile-Stück – da mache ich zwar jetzt einen Riesensprung, aber wir können ja sofort wieder zurückgehen –, wo sich der weiße Boden auftut, als ob Eisschollen auseinanderbrechen, aber außer diesem Boden eben rein gar nichts auf der Bühne passiert. Das ist ja in meiner Sicht, wenn ich alle Bilder Revue passieren lasse, das kargste.
Aber da sind wir ja noch nicht, wir sind ja da erst bei ...
Peter Pabst: ... Nefés. Das war die Koproduktion mit Istanbul. Wieder eine Stadt, die man gar nicht bebildern kann! Das war wohl eher eine Art Absetzbewegung meinerseits von dieser Bilderflut, die zu dieser Kargheit geführt hat. Ich hab Istanbul sehr geliebt! Das ist eine der Städte in meinem Leben, da bin ich hingekommen und es hat „peng!“ gemacht und ich wollte da bleiben. Ich fand das ganz toll da, aber irgendwie konnte ich das nicht bebildern. Ich habe damals wirklich sehr viele Versuche gemacht.
Wim Wenders: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Gerade, weil das so bildhaft ist, ist das dann schwierig, dem eine Bühne zu geben.
Peter Pabst: Ja, also das war dann so, und ich bin auch sehr froh mit dieser Reduktion, die als Bühnenbild fast ein „Nichts“ zu sein scheint, allerdings ein elegantes.
Und ich habe mich dann wohl in der nächsten Zeit nur damit beschäftigt, für das „Nichts“ die komplizierteste Version zu finden.
Peter Pabst: Zunächst einmal findest du nur Gegensätze, die einander nicht dulden. Ein schöner dunkler Boden aus geölten Holzplanken und die Tänzer. Das geht nicht gut. Tänzer haben einfach eine Höllenangst vor Splittern.
Dann ein eleganter geölter Dielenboden und Wasser, das ist auch nicht gut.
Wim Wenders: Das quillt auf und verformt sich.
Peter Pabst: Ja, aber noch schlechter ist, wenn das Wasser nur zeitweise da ist.
Und wie du dir sicher denken kannst, hatte Pina gleich gefragt: „Muss der See immer da sein?“ „Nein, natürlich nicht“, sagte ich – also Wasser nur zeitweise und schon wird’s wieder schwerer!
Wenn aber der See nicht immer da sein sollte, musste er ja irgendwoher kommen und wieder irgendwohin gehen. Ich dachte, wenn man sieht, wie das Wasser eingelassen wird, ist das langweilig.
Nein, das Wasser muss von unten durch die Dielen kommen!
Das hieß nun wieder, dass ich einen doppelten Boden brauchte, den man aber als solchen nicht erkennen durfte. Wenn das dann durch den Boden gesickert käme, würde das etwas Irritierendes haben, wenn da plötzlich Flecken auf dem Boden sichtbar würden. Das hätte so etwas von Grundwasser, und der Moment, wenn das aus dem Untergrund hochkäme, wäre irritierend, und das mochte ich.
Wim Wenders: Im Theater ist das allerdings höchst beunruhigend, wenn da plötzlich Wasserflecken auf dem Boden auftauchen ...
Peter Pabst: ... und man nicht weiß, ist da was kaputtgegangen, ist das Öl oder was ist da passiert? Es wird auch immer mehr.
Deshalb fand ich wichtig, dass das am Ende wieder eine ganz schöne Form finden würde. Ganz rund! Deshalb musste da eine Kreisform entstehen.
Auf alle Fälle war ich bei der Suche nach der kompliziertesten Lösung für das „Nichts“ auf der Bühne so erfolgreich, hatte eine solche Palette von Schwierigkeiten zusammengestellt, dass ich am Abend vor dem Aufbau auf der Bühne nur noch hätte heulen mögen. Kurz vor Mitternacht saß ich da mit Pina und habe zu ihr gesagt: „Pina, ich glaube, morgen werden wir kein Bühnenbild mehr haben. Die Tänzer werden nicht auf dem Boden tanzen wollen und das Wasser wird nicht funktionieren, ich habe alles falsch gemacht. Es tut mir leid.“
Aber dann hat doch alles gestimmt, Nefés fand statt und Pina hat es sehr gerne gespielt.
Wim Wenders: Bei dem nächsten Stück sieht die Schwanzflosse eines Walfisches aus wie das Heck eines Flugzeuges und dann schneit es wieder. Was hat denn diesmal so schön vom Bühnenhimmel geschneit? Und wie konntest du Pina überreden, dass die Wale diesmal nicht weggehen mussten?
Peter Pabst: Die Wale hatten mich schon lange vorher beschäftigt. Ich hatte sie auch Pina schon früher mal gezeigt, aber dann waren sie wieder verschwunden. Ich mochte die aber so. Deshalb habe ich noch mal damit angefangen. Auch weil das Stück mit Japan verbunden war, wir haben es dort in Saitama gespielt. Aber nicht wegen der Walfangstreitereien mit Japan, sondern weil die Wale für mich etwas ausstrahlten, das sich einfach mit Japan verband.
Mit diesen Empfindungen hing auch zusammen, dass dieses Mal etwas ganz anders war. Sonst habe ich ja alles, was ich gemacht habe, als „Spielzeug“ für die Tänzer gemacht. Sie sollten es in Besitz nehmen und damit spielen. Bei den Walen ist mir irgendwann – nicht von Anfang an – klar geworden, dass sie „Unberührbare“ sind. Und es hat mich gefreut, dass die Tänzer die nicht anfassten.
Wim Wenders: Hm. Und der Schnee?
Peter Pabst: Das mit dem Schnee war einfach. Zunächst einmal gab es da einen ganz einfachen formalen Gedanken. Die Wale auf der schwarzen Bühne, das war wieder so ein meditatives, dunkles Bild. Wie wäre es, wenn dieses schwarze Bild im Laufe der Zeit weiß würde? Schwarz wird weiß.
Wim Wenders: Da hattest du also deine Veränderung.
Peter Pabst: Ja, dass es einfach weiß wird.
Wim Wenders: Alles bleibt, aber es verändert sich trotzdem.
Peter Pabst: Genau. Und den Schnee hab ich ganz klassisch gemacht, mit langen Schneetüchern in den Zügen und mit Papierflocken. Und Bühnentechniker ziehen ganz sacht und regelmäßig an den Zugseilen, bewegen so die Schneetücher, und der Schnee fällt heraus. So machte man das schon im Barocktheater.
Dass es aber so schön schneit, wie du sagst, hat einen Grund, auf den ich ein bisschen stolz bin. Ich denke – und das ist auch mein Ehrgeiz –, dass es wirklich nicht immer neu ist, was ich mache, aber es ist eigentlich immer besser gemacht. Und so war das mit dem Schnee auch, der fällt aus den Schneetüchern immer in einer Linie. Das kann man in der Luft nicht erkennen, aber auf dem Boden hat man dann eine, zwei oder drei mehr oder weniger breite Linien und dazwischen ist es schwarz. Das wollte ich nicht. Also hab ich einen Schnürboden gemacht. Ich glaub, ich hab sechsundvierzig Ventilatoren da oben angebracht, die sich bewegen und die mir den Schnee aus den Tüchern herauswehen, jeder in eine andere Richtung. Das heißt, es schneit überall auf der ganzen Bühne! Und vielleicht ist es auch deswegen so schön, weil der Schneefall zum Stückende hin immer stärker wird, bis hin zu einem wirklichen Schneesturm, und weil ich darauf bestanden habe, dass, nachdem es im ersten Teil von Ten Chi angefangen hat, zu schneien, es einfach nicht mehr aufhört. Nicht während der Pause und auch nicht nach Ende der Vorstellung, so lange, bis der letzte Zuschauer gegangen ist.
Wim Wenders: Die Zuschauer müssen denken, das geht bis morgen weiter ...
Peter Pabst: ... da sind die auch immer fassungslos. Ich wollte am Schluss auch wirklich einen Blizzard haben. Da spielt diese wilde Musik, die ich über alles liebe, und die Tänzer tanzen so toll, und wenn es richtig gut gemacht ist, kommen sie immer aus dem Nirgendwo, tauchen wirklich auf aus dem Schneesturm. Und verschwinden wieder darin. Wenn es so ist am Abend, ist es herrlich.
Wim Wenders: Frau Holle könnte sich zu dir in die Lehre begeben.
Peter Pabst: Sagen wir mal so: Ich hätte vielleicht die Gesellenprüfung bei Frau Holle bestanden.
Aber es ist schon eine Gemeinheit für die Techniker! Die kriegen schon ganz schön lange Arme – zwei Stunden für Frau Holle an den Zugseilen. Aber das finde ich einfach toll an ihnen. Die müssen bei mir immer wie die Verrückten arbeiten, riesige Installationen bauen, wir sind immer zu spät dran und am Ende kommen dann noch zwei Stunden Schnee.
Ich werde oft gefragt, ob die Mitarbeiter mich nicht hassen. Gut, sie fluchen auch und stöhnen manchmal, wenn sie mich nur sehen, aber sie machen die Arbeit gerne und am Ende haben sie glänzende Augen und fragen: „Wann kommst du denn wieder?“
Wim Wenders: Ich glaube, das ist der Spieltrieb in dir, der einfach auch ansteckend ist.
Peter Pabst: Der macht ihnen Spaß! Und die wissen, dass ich mit ihnen denke. Sie haben mit mir einen kompetenten Gesprächspartner, auch wenn sie über Technik oder handwerkliche Probleme reden, und sie wissen genau, dass ich ihnen zuhöre. Ich hebe nicht den Finger und sage, das ist aber mein Einfall, der ist kostbar, und deshalb muss das so und so gemacht werden.
Wim Wenders: Wenn wir zum nächsten Stück gehen, dann zeigt das: Ein Eisberg ist auch eine Projektionsfläche ist auch eine Kletterwand ...
Dass und vor allem wie man daran herumklettern kann, wussten die Tänzer erst, als das Ding auf der Bühne stand. Die „Erkundung des Ortes“, den du ihnen gebaut hast, können sie ja noch nicht in der Lichtburg begonnen haben. Wie wurden solche Szenen dann entwickelt, wenn sie doch erst in der Schlussphase eines Stückes entstehen konnten, eigentlich nach den Proben?
Peter Pabst: Wie und wo man an dem Eisberg entlangklettern könnte, habe ich mir während der Konstruktion überlegt. Die Vorbereitungen dafür sind ähnlich kompliziert wie bei einer echten Bergroute. Und dabei habe ich natürlich über Wege und Bewegungen nachgedacht, die dabei entstehen würden. Und ich habe einen Verein von Alpinisten begeistern können, die in Rough Cut jetzt bei uns klettern. Aber das alles war nur Teil der Vorbereitung.
Das Außergewöhnliche an dieser Form der „Besitzergreifung“ während der letzten Tage auf der Bühne waren aber immer wieder die große, verspielte Fantasie und die unglaubliche Schnelligkeit, mit der Pina und ihre Tänzer so eine Landschaft begriffen und belebt haben.
Pina konnte wie niemand anderer in wenigen Augenblicken die Möglichkeiten eines Bühnenbildes erkennen, mit ihren eigenen Bedürfnissen abgleichen und es für sich und die Tänzer nutzen. Ich denke, dass Pina im Umgang mit neuen Bedingungen so frei war, weil sie in jedem Moment bereit war, alles, was sie gemacht hatte, wieder zur Disposition zu stellen – bis sie mit etwas zufrieden war. Dann hat sie es allerdings nicht mehr losgelassen.
Ich glaube, dass diese so wenigen Tage und Stunden, in denen Pina und die Tänzer mein Bühnenbild besetzten, die Zeit meines größten Glücks waren. Das war immer einfach nur schön mitzuerleben, es war nie billig – in fast dreißig Jahren kein einziger „Ausrutscher“ –, sondern fantasievoll, sophisticated und voller Raffinesse.
Darin lag der Grund für die Freiheit meiner Arbeit, die bei Pina größer war als woanders. Was immer ich machen würde, ich konnte sicher sein, dass sie es auf solche Art und Weise nutzen würde. Wahrhaft ein großes Privileg!
Wim Wenders: Über dein Set für Vollmond weiß ich ja nun nach unseren Dreharbeiten am meisten. Da liegt ein gewaltiger Felsbrocken über einem Fluss. Wie ist die Form dieses Felsens entstanden und wann und wie haben Pina und die Tänzer die Durchschwimmbarkeit des Flusses entdeckt?
Peter Pabst: Die Form das Felsens ist ganz einfach entstanden. Als einzige „Brücke“ über den Fluss wollte ich einen Felsen haben. Ich habe so lange gesucht, bis ich einen Stein hatte, der diesen Felsen im Modell – Maßstab 1:25 – darstellen konnte. In einem Steinbruch bei Wuppertal habe ich ihn schließlich gefunden, da lag er.
Das mit dem Schwimmen ist ganz ähnlich entstanden wie das Klettern. Ich habe für die Tänzer einen schönen, sinnlichen Fluss gemacht, warm und angenehm, damit sie gerne ins Wasser gingen. Und hier kam wieder Pinas innere Freiheit ins Spiel: Natürlich ist das Wasser viel zu flach, jeder normale Mensch würde gar nicht über Schwimmen nachgedacht haben. Aber so was hat Pina eben gar nicht interessiert: „Schwimmt doch mal den Fluss entlang.“ Und was für eine schöne Bewegung ist dabei entstanden! Aber eigentlich hat sie sich dabei mehr für das Lächeln der Frauen beim Schwimmen interessiert.
Wim Wenders: Was kannst du mir über den Nieselregen und über den heftigen Regen erzählen?
Peter Pabst: Ich nenne sie „kleiner Regen“ und „großer Regen“.
Am Anfang haben in den Gesprächen zwischen Pina und mir die Jahreszeiten eine Rolle gespielt. Aber wir sind immer wieder am Sommer gescheitert, weil man da immer an die Intensität des Sonnenlichtes denkt. Und natürlich kann man das nicht mit Scheinwerfern herstellen. Dann denkt man über Jalousien nach und ihre Schattenstreifen. Aber das ist natürlich alles Quatsch und bringt gar nichts.
Dabei fällt mir ein, dass Pina in dem Stück 1980 ein wunderbares Sommerbild auf der Spielwiese gemacht hat. Da kamen nach und nach alle Tänzer auf die Bühne, manche geschlendert, manche eher eilig und direkt, manche zögernd und unentschlossen, und alle suchten sie einen Platz in der Sonne. Aber jeder wollte nur einen bestimmten Körperteil sonnen, hat also nur diesen Teil entblößt und versucht, ihn der Sonne entgegenzustrecken. Ich bin sicher, es hat auf dem Theater noch nie einen so heißen Sommer gegeben. Damals hatten wir nur ganz wenig Licht. Und trotzdem war es heiß! Manchmal denke ich, das Schönste im Theater sind die Umwege ...
Jedenfalls bin ich von den Jahreszeiten aufs Wetter gekommen und damit auf den Regen. Ich wollte immer schon so einen monsunartigen Regen machen, dessen dicke Tropfen auf dem Pflaster zerplatzen und Blasen ziehen.
Ich glaube, da hat so eine Kindheitserinnerung mitgespielt. Als ich so fünf oder sechs Jahre alt war, bin ich im Sommer immer von zu Hause ausgerissen, wenn ein Gewitter war, und bin wie besessen nackend im Rinnstein unserer Straße auf und ab gerannt. Angst vor Blitz und Donner kannte ich noch nicht, aber es war warm und hat so toll gespritzt!
Jedenfalls habe ich ganz schön lange an meinen beiden Regen rumgebastelt, mit interessanten Leuten über technische und physikalische Zusammenhänge gesprochen und wieder einmal viel gelernt.
Den feinen dichten Nieselregen habe ich gemacht, weil ich da hinein ursprünglich Bilder projizieren wollte, auf die feinen Wassertropfen. Das sah auch total verrückt aus, wir haben es in der knappen Zeit aber nicht mehr geschafft, den richtigen Platz im Stück dafür zu finden. Also habe ich die Projektionen weggelassen.
Ich wusste auch, dass man solche „Regenvorhänge“ fertig kaufen kann. Die waren mir nur zu klein und so teuer, dass ich sie nicht bezahlen konnte. Deshalb habe ich mir meinen „kleinen Regen“ selbst gemacht.
Als ich dann den „großen Regen“ zwischen den Proben zum ersten Mal ausprobiert habe, saß Pina im Zuschauerraum hinter mir. Ich erinnere mich wie heute, dass ich mich zu ihr umgedreht habe und gesagt habe: „Schau mal, Pina, da ist unser Sommer.“
Pina lächelte und nickte. Das wusste ich inzwischen als ein Zeichen geradezu enthusiastischer Zustimmung zu schätzen.
Wim Wenders: In Bamboo Blues wehen Vorhänge, Vorhänge, Vorhänge. Das muss doch eigentlich ausnahmsweise mal keine technischen Herausforderungen dargestellt haben. War das also ein Low-Budget-Set?
Peter Pabst: Das war so meine Metapher für Indien: zartes Gewebe und Wind.
Wenn man ein Stück durch indische Theater touren lassen möchte, tut man halt gut daran, die Technik nicht zu komplex werden zu lassen. Aber Low Budget – weit gefehlt! Das waren ja schon 1,6 Kilometer Stoff, 6400 Quadratmeter! Eine Windmaschine, mit der man normalerweise Autobahntunnel entlüftet, und circa vierzig bewegliche Ventilatoren.
Dazu hab ich dann Projektionen in mehrfachen Lagen ausprobiert, „multi layered“ sozusagen.
Ich habe zum Beispiel Wind in die Stoffbahnen fauchen lassen, das dann gefilmt, den Film wieder auf die stürmischen Stoffbahnen geworfen und dazu noch eine Lage von oben auf den Boden projiziert. Also, die Grenzen der Theater in Indien haben wir schon ausgelotet. Der ganze erste Teil findet praktisch ohne Licht statt, nur in diesen Projektionen, und die Tänzer werden von „Follow Spots“ begleitet.
Wim Wenders: Und zuletzt die Uraufführung 2009, das Chile-Stück: ... como el musguito en la piedra, ay si, si, si ... (... wie das Moos auf dem Stein ...), wie es jetzt heißt.
Das ist lange Zeit nichts als eine wunderschöne große, weiße Fläche. Aber dann merkt man, dass man dem Schein nicht trauen kann. Der Boden tut sich auf, in diesem Fall der Tanzboden ...
Man denkt an die Antarktis und an Eisschollen. Gibt es da Parallelen zu den Eisbergen in Rough Cut?
Peter Pabst: Nein, die gibt es nicht.
Zu diesem Bühnenbild weiß ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Auch das hat seine Bedeutung durch Pina gefunden.
Wim Wenders: Jetzt sind wir die knapp dreißig Jahre chronologisch durchgegangen, die du mit Pina gearbeitet hast. Haben wir irgendein Stück vergessen?
Peter Pabst: Vergessen haben wir Nur Du, die Koproduktion mit den Universitäten UCLA, Berkeley, Tempe in Arizona und der University of Texas in Austin. Da hat Pina es sogar geschafft, in dem Probenraum von UCLA zu rauchen!
Und ich habe es geschafft, eines der wenigen Dinge auf die Bühne zu stellen, die ich in der ganzen Research-Periode nicht zu Gesicht bekommen habe. Nämlich sieben riesige Stämme von Redwood Trees, was das Transportvolumen auf sechs riesige, vierzig Fuß lange Container hochgetrieben hat, was dazu geführt hat, dass wir dieses Stück nur ganz selten spielen konnten. Schade eigentlich, es ist ein sehr schönes und verrücktes Stück.
Und ebenfalls vergessen haben wir Sweet Mambo aus dem Jahr 2008. In der Saison wollten wir eigentlich gar keine Neuproduktion machen, weil jemand im Jahr zuvor ein ziemlich großes Defizit errechnet hatte und Pina deswegen sofort entschieden hatte, dass wir zwanzig Vorstellungen mehr spielen würden, um Geld zu verdienen und die Löcher zu stopfen. Um das möglich zu machen, hatten wir uns schweren Herzens entschlossen, kein neues Stück zu machen.
Das hat sie aber doch nicht ausgehalten und hat mit den Tänzern, die im Vorjahr nicht mit in Indien waren, Sweet Mambo gemacht. Um nun nicht doch wieder Geld auszugeben, habe ich die Basis des Bühnenbildes von Bamboo Blues benutzt. Ich wollte am liebsten das ganze Stück vor der schwarz-weißen Kulisse eines projizierten Kinofilms der Dreißigerjahre spielen lassen. Der Film sollte eine Heimat für das Stück werden. Ausgesucht hatte ich dafür den Film Der Blaufuchs mit Zarah Leander und Willy Birgel.
Ganz so weit ist Pina dann doch nicht mitgegangen, aber wir haben einige lange Sequenzen aus diesem Film benutzt, und ich habe gelernt, was für ein fantastischer Schauspieler der Willy Birgel war. Und unsere Tänzer waren es auch. Ein schönes Stück, klein, aber fein.
Wim Wenders: Den Spieltrieb, den du in dieser ganzen Zeit ausgetobt hast, kanntest du den schon in dir, oder hat Pina den angestachelt? Hast du dich sozusagen anstecken lassen, in deiner Fantasie zumindest, zum Tänzer zu werden und dir vorzustellen, welche Bühne und welche Hindernisse für die Tänzer jeweils eine neue Herausforderung darstellen würden?
Peter Pabst: Verspielt war ich eigentlich immer. Ich denke, ich habe mich ziemlich erfolgreich gewehrt, erwachsen zu werden, und habe versucht, mir eine gehörige Portion Naivität zu bewahren, weil die wiederum eine ziemlich ertragreiche Form der Neugier hervorbringt.
Schauspieler zu lieben, das hat mir schon Peter Zadek beigebracht. Also in ihre Fantasien hineinzukriechen und das Bühnenbild nicht nur als Heimat für sie, sondern auch als Hindernis, als Herausforderung zu nutzen, das hab ich auch schon bei ihm gelernt. Nur ist der „physische Dialog“ mit Pinas Tänzern viel direkter und intensiver. Und nie waren Schauspieler so mutig wie unsere Tänzer.
Vor allem aber: Niemals zuvor hat mir jemand so viel Freiheit eingeräumt wie Pina. Und bei allen Schwierigkeiten, niemals sonst habe ich so sorglos spielen dürfen.
Wim Wenders: Wie anders ist deine Arbeit, wenn du für das Tanztheater etwas erfindest, im Gegensatz zur Arbeit in der Oper oder im Theater?
Peter Pabst: Das ist sehr anders. Schon deshalb, weil es im Theater meist von Anfang an eine sehr konkrete Struktur als Ausgangspunkt gibt: ein geschriebenes Stück. In der Oper ist diese Struktur noch fester, weil zu dem Text noch die mathematisch genaue Partitur dazukommt. Da wird die Arbeit sehr leicht konzeptioneller. Das liegt auch an den Theaterstrukturen, an den großen Opernhäusern in der Welt muss ich die Entwürfe mindestens zwölf bis achtzehn Monate vor Beginn der Proben abliefern, zu einem Zeitpunkt also, an dem ich beim Tanztheater noch nicht einmal das Vorjahresstück angefangen habe. Die Menschen empfinden und denken sehr anders in der Oper und im Schauspiel und damit werden auch die Themen oder die Schwerpunkte für meine Arbeit anders. Und wenn ich ab und zu einen Film gemacht habe, war das nun wirklich eine vollkommen andere Welt.
Ich habe es immer als einen besonderen Vorzug empfunden, dass ich in all diesen Formen arbeiten durfte, und habe die Gegensätze als Schule, als Formenschule, für mich selbst benutzt. Ich habe dadurch viele unschätzbare Erfahrungen gemacht.
Wim Wenders: Was war bei diesen Bühnenbildern rein „tanzspezifisch“ und was würdest du dabei „Pina-spezifisch“ nennen?
Peter Pabst: „Tanzspezifisch“ ist für mich „Pina-spezifisch“. Ich habe für den Tanz mit einer Ausnahme, dem Ballett Hurlevent für die Opéra de Paris, nur mit Pina gearbeitet. Ich verstehe nichts vom Tanz.
Ich fürchte nur, dass die meisten Tanzcompagnien mich aus dem Haus gejagt hätten, wenn ich ihnen etwas von dem vorgesetzt hätte, was ich Pinas Tänzern im Laufe unserer neunundzwanzig gemeinsamen Jahre zugemutet habe. Ich habe denen ja oft genug Steine und manchmal auch Felsbrocken vor die Füße geworfen.
Wim Wenders: Was sie nicht daran gehindert hat, um so befreiter zu tanzen. Auch mit deinen Felsen hast du ihnen im wahrsten Sinne des Wortes „Frei-Räume“ geschaffen.
Der Text wurde erstmals im Buch Peter für Pina veröffentlicht. Erschienen 2010 im Verlag Kettler.